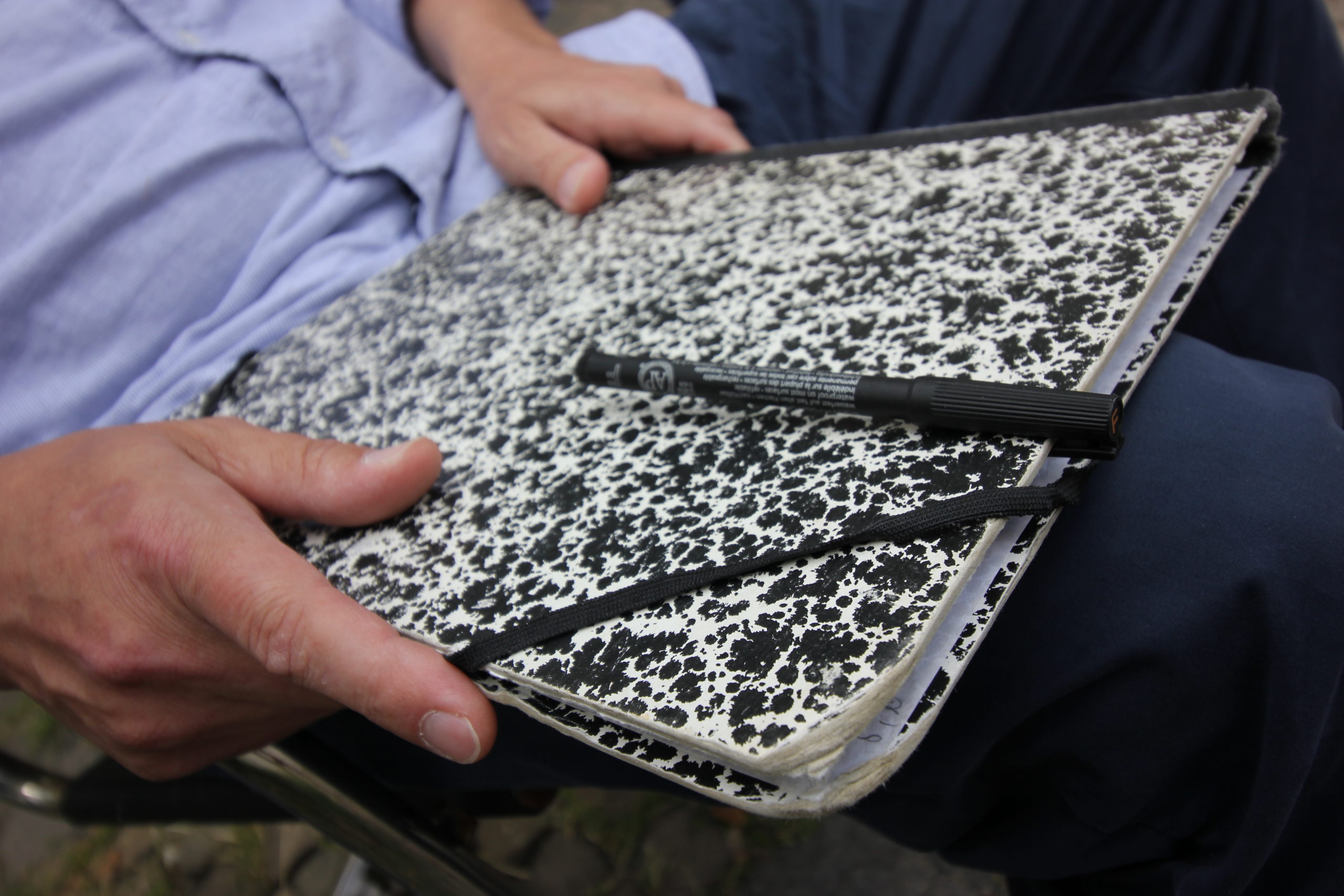Prolog: Was bisher geschah oder: Europa der offenen Grenzen
17. März 2020

Was macht dich zum Europäer?
Kannst du dich noch daran erinnern, wann du dich das erste Mal bewusst als Europäer gefühlt hast?
Und wann das letzte Mal?
Welche drei Worte kommen dir als erstes in den Sinn, wenn du an Europa denkst?
Was findest du gut an Europa? Was stört dich?
Wenn du die Macht hättest, etwas in Europa zu verändern, was wäre es?
Unter anderem diese Fragen habe ich im Februar 100 Menschen gestellt – während meines Artist in Residence-Projekts zum Thema Europa – in Vechta, einer Stadt in Niedersachsen.

Im Februar, zu einer Zeit, als Corona noch nicht unseren Wortschatz, unseren Alltag, bestimmt hat. Teilweise keinen Monat her, als wir noch gar nicht wussten, was das überhaupt ist, als Corona in unseren Ohren noch klang wie eine Stadt in Spanien, SARS und COVID wie „irgendwas im All“ oder Aliens in Science-Fiction Romanen.

Im Februar, als ich und meine Schreibmaschine 100 unterschiedliche Menschen interviewt haben: Geflüchtete Kinder („wir sind gar keine Europäer“), einen Grafen, Hausfrauen, Finanzbeamte, einen Uni-Präsidenten, den Bürgermeister, einen 92-jährigen, der den letzten Weltkrieg miterlebt hat, Familien, Kinder, eine 2-jährige, die an Europa „Schnuffi“, ihren Plüschhund mag, Krankenschwestern, Reinigungskräfte, Menschen, die kaum ein Wort Deutsch sprachen, eine Literaturwissenschaftlerin, Schüler*innen und Student*innen – teilweise mit zwei Staatsangehörigkeiten, teilweise aus anderen Länder in- und außerhalb Europas.
100 Menschen von 2 bis 92 Jahren.
100 Menschen, deren Gehalt von 80€ im Monat innerhalb eines Wiedereingliederungsjobs bis hin zu (vermutlich) mehreren tausend Euro durch riesigen Landbesitz und mehrere Geschäfte und Betriebe reicht.
100 Menschen, deren Ausbildung von einem internationalen Studium in mehreren Ländern bis hin zu „fragen Sie mich nichts, ich weiß nichts, ich hatte keine Schulbildung, ich war nur in der Volksschule“ reichte.
100 Menschen – wie sie auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher hätten sein können. Aber einige Gemeinsamkeiten ließen sich durch die Interviews doch feststellen…
Alle waren sie sich einig, was sie an Europa schätzen, in fast allen 100 Interviews fielen diese Begriffe: „Weltoffenheit, kulturellen Austausch“, „Mobilität, Kultur, über die Grenze fahren einfach“, „dass es eigentlich keine Grenzen gibt“, „Reisefreiheit“, „das Leben in Europa ist ein sehr stabiles Leben“.
Eine Schülerin meinte: „Ich fühl mich tatsächlich in der letzten Zeit auch europäisch, weil wir das Privileg haben von gewissen Krankheiten verschont zu bleiben.“
Keine 30 Tage später ist die Headline bei der Tagesschau „Kontrollieren, Abschotten, Schließen“.
Frankreich verordnet eine Ausgangssperre, Deutschland kontrolliert seine Grenzen, die Verordnung, Veranstaltungen abzusagen, alle Urlaube zu unterlassen, Restaurants um 18 Uhr zu schließen, zuhause zu bleiben, lässt in mir immer noch den Reflex hochsteigen, mich in den Arm zu zwicken. Passiert das hier wirklich?
Eine Generation wie meine, die noch nie einen Ausnahmezustand erlebt hat, für die Kriege innerhalb der eigenen Landesgrenzen, die Mauer in Deutschland, Seuchen vergilbte Seiten aus dem Geschichtsbuch sind, Zeitzeugenberichte, Romane, Filme vielleicht, aber doch nicht Alltag?
Die Unsicherheit in der Bevölkerung wird zu Panik. Man hört von Hamsterkäufen, sieht auf der Timeline Fotos von Menschen, die mit Gesichtsmasken tonnenweise haltbare Lebensmittel einkaufen. Im ersten Moment lacht man, vielleicht, als ich Samstagabend um 19 Uhr noch etwas Obst und Gemüse im Supermarkt kaufen will, muss ich feststellen: Alle Regale sind leer. Eine Gurke liegt noch in der Ablage. Ich nehme sie. Zuhause stelle ich fest, dass sie eingedrückt ist und schon schimmelt.
Wirklichen Mangel, das etwas fehlt, was man kaufen möchte, habe ich das erste Mal bei meiner Kuba-Reise erlebt. Hier noch nie.
Ausgangssperren und Grenzschließungen waren für mich Filmsequenzen aus V for Vendetta, Fiktion im Rahmen von historischer Literatur, etwas, was außerhalb passiert, nicht hier.
Hier wollte ich mit den Menschen der Rheinschiene über ihren Alltag sprechen, mit ihnen das Besondere des Alltags herausfiltern, über den Wunschalltag sinnieren. Wollte ihre Aussagen zum nächsten Menschen weitertragen, um so nicht nur einen Dialog zwischen mir und der interviewten Person, sondern auch der Menschen untereinander zu bewirken.
Am Sonntag habe ich mein vorerst letztes Interview geführt. Mein Interviewpartner hat zwischendurch ein paarmal gehustet. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich überhaupt nicht beunruhigt hat. Ein Interview ist eine nahe Angelegenheit. Vor allem mit der Schreibmaschine. Das Tippen ist so laut, dass man beieinandersitzen muss, um sich trotzdem zu verstehen. Ich wollte ein Schneeballsystem erschaffen. Aber kein Schneeballsystem der Viren. Ich wollte Aussagen weitertragen, Alltage verbinden – aber keine Krankheiten. Nicht nur die Welt wankt, auch meine Projektidee.

Ein Erasmus-Student, der in Italien bei den sog. Corona-Partys mitgefeiert hat, richtet in seinem Artikel (https://www.bento.de/gefuehle/coronavirus-erasmus-student-aus-italien-appelliert-bleibt-zu-hause-a-ee134ebb-8938-4e23-a475-c2cfa7a1b1ea?utm_source=pocket-newtab) einen Appell an uns alle: „Macht es besser als ich“. Er schreibt: „Der Alltag hat sein eigenes Momentum, seine eigene, langsame Wucht. Und ich habe mich einfach weiter von ihm mitziehen lassen.“
Das zeigt einmal: Der Alltag gewinnt gerade in einer Zeit, in der der Alltag vollkommen aus der Bahn geworfen wird, eine neue Bedeutung. Vielleicht war uns seit Jahrzehnten nicht mehr so bewusst, was Alltag bedeutet, was Alltag alles beinhaltet. Vielleicht können wir jetzt oder nach dieser Krise, wann auch immer das Ende sein wird, unseren Alltag besser reflektieren, schätzen ihn mehr, weil uns bewusst geworden ist, wie wertvoll er ist.
Und es zeigt: Wir sollten stark genug sein, um uns nicht von dieser Wucht mitziehen zu lassen. Wir sollten auf den eigenen Spaß, das eigene Vergnügen verzichten, um etwas Zeit zu gewinnen. Obwohl wir nicht zur Risikogruppe gehören – und gerade deshalb. Wer gesund ist, kann die freie Zeit nutzen, um endlich wieder raus in die Natur zu gehen, einen Waldspaziergang zu machen, ein gutes Buch lesen, sich Zeit für sich nehmen. Risikogruppen, die in Apotheken müssen, in Krankenhäuser, zum Arzt – und das oft aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – sind darauf angewiesen, dass wir Ihnen genügend Raum lassen, um alles gefahrlos zu nuten – und genügend Utensilien, um behandelt werden zu können. Menschen, die nur noch unter Schmerzen gehen können, sind darauf angewiesen, dass im Supermarkt im Ort noch Klopapier vorrätig ist, dass ihr Arzt seine Hände desinfizieren kann.

Im nächsten Post: Die Welt krankt sich gesund oder: Wie wir durch Corona uns und der Natur einen Gefallen tun können.
Ihr habt auch Ideen? Schreibt mir!