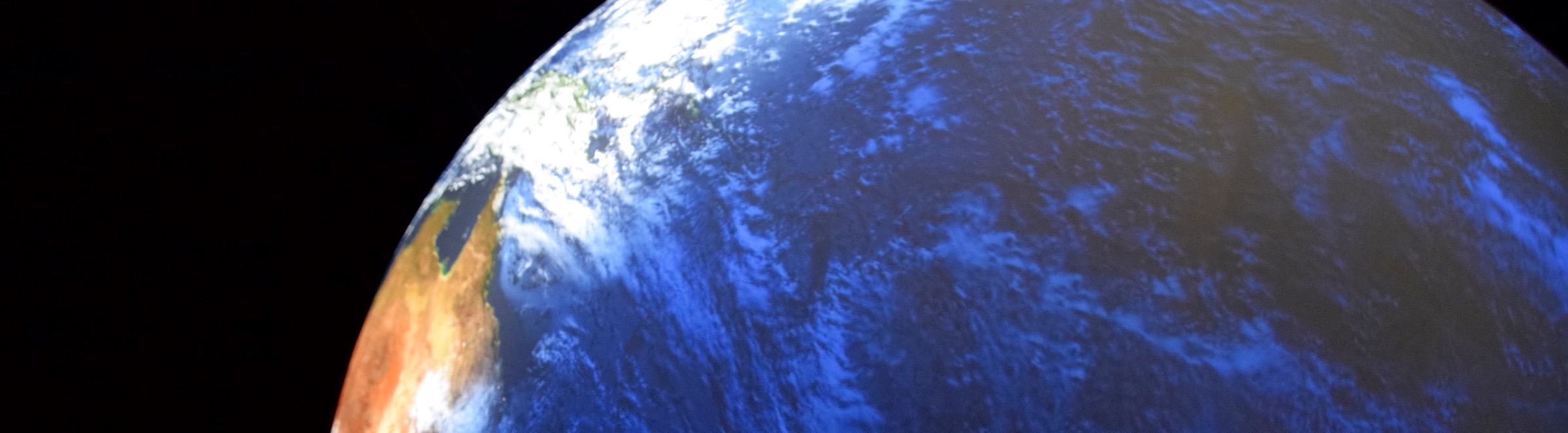Die Stadt der Utopisten
24. Oktober 2017
Utopist, der
Wortart: Substantiv, Maskulin
Bedeutungsübersicht: Jemand, der utopische Pläne und Vorstellungen hat;
Synonyme: Anarchist, Revolutionär, Schwärmer, Träumer, Fantast
Man muss schon sagen, ginge es nach dem Duden, spricht nicht allzu viel für das Dasein eines Utopisten. Er oder sie, werden dem Fantasten gleichgesetzt, einem Menschen, der zwischen Wirklichkeit und Wunschvorstellung nicht unterscheiden kann. Die Anzahl eben dieser sollte man möglichst klein halten, zum Beispiel mit der Schultüte. Ach, die Schultüte, wie könnte es passender sein, ein Trichter. Erst kommen noch ein paar Süßigkeiten, doch schon bald wird der Geist mit der Realität zwangsernährt.
Davon lassen sich die Wuppertaler nicht beeindrucken, sie beweisen, dass aus dem Spagat zwischen Wunschvorstellung und Realität erst eine Utopie und dann Tatsachen werden können.


Beweisstück A: Bahnhof Wuppertal-Mirke. 1882 erbaut und auch heute noch schön wie eh und je. Selbstverständlich mit typisch Bergischer Schieferfassade. Das der Bahnhof in diesen Tagen genutzt wird, ist jedoch nicht selbstverständlich, gut 20 Jahre stand er leer.
Wir betreten die Eingangshalle und stoßen auf den Charme jener Industriellen Revolutionsjahre, doch kein Mensch wartet hier auf einen Zug, höchstens auf den Kaffee. Gehen wir einmal quer durch den Raum und raus auf den Bahnsteig.


Beweisstück B: Die stählernen Dampfkolosse wurden längst durch zweizylindrige Drahtesel ersetzt. Die Nordbahntrasse, ehemals Verbindungsglied zwischen Düsseldorf und Dortmund, lag ebenfalls lange brach. Solange bis die Wuppertaler das Zepter in die Hand nahmen. Aus einem 23 Kilometer langen Abschnitt der stillgelegten Bahnstrecke wurde in Wuppertal ein Radweg, Mensch und Natur sind hoch erfreut. Hefeweizen und Schweiß statt Kohle und Wasserdampf.
Wuppertal mit Volldampf in die Zukunft? Es scheint fast so, die Utopisten sind los und machen ihrem, in Verruf geratenem Namen, alle Ehre.
Zunächst jedoch ein kleiner Rückblick in die Vergangenheit: Ein jeder weiß über die Textilindustrie Wuppertals bescheid, die es zum „Manchester Deutschlands“ machte. Hervorzuheben ist dabei vor allem der Wuppertaler Johann Gottfried Brügelmann, jener Herr, der bereits im 18. Jahrhundert das Potenzial maschineller Produktion erkannte und einen Freund zum Spionieren nach England schickte. Der Rest ist Geschichte, in Ratingen erfolgte das Copy-Paste-Verfahren, die erste Webmaschine auf europäischem Festland und ein Grundstein für die Industrielle Revolution war gesetzt.
Als diese gut fünf Jahrzehnte später in vollem Gange war, kam ein anderer Wuppertaler mit einer ganz anderen Sicht der Dinge. Kein Geringerer als Friedrich Engels sah die Schattenseiten einer auf Effizienz und Wachstum basierenden Produktion der Maschinen und schrieb mit seinem Kumpel Karl Marx eine der berühmtesten Utopien: jene zur klassenlosen Gesellschaft. (kurz gesagt wollten die beiden Fischen, Jagen und Viehzucht betreiben, ohne überhaupt etwas davon gelernt zu haben.)
Und jetzt spannen wir einen Bogen von Brügelmann und Engels zum Mirker Bahnhof? So ist es! Denn dieser wurde durch den 2011 gegründeten Verein «Utopiastadt» mittels Spenden, wie Fördergeldern revitalisiert und zum Treffpunkt für kreative und kulturelle Stadtentwicklung gemacht. Die Mitglieder beschreiben den Ort nun als ein «Stadtlabor für Utopien», ebenfalls mit dem Namen «Utopiastadt».
Ähnliches geschah mit der bereits erwähnte Nordbahntrasse durch den Verein «Wuppertal Bewegung».
Bevor sich diese Bürgerinitiativen dem Mirker Bahnhof und der Trasse angenommen hatten, stand das Gebäude brüchig und leer in der Gegend herum und die Gleise nicht zu gebrauchen. Die Industrialisierung hat sich selbst den Schwanz abgebissen, Europa hat bezüglich Textilindustrie gewissermaßen den roten Faden verloren.
Die Zeit war also mehr als reif für Utopisten und diese haben allerhand innovative Ideen für die Zukunft:
Hier gibt es Atelier- und Agenturräume, eine Gemeinschaftswerkstadt, Fahrradreparatur und kostenloser Verleih, ein Stadtgarten statt Betonwüste und flexibles Co-Working statt nine-to-five in der Großraumbürozelle. Man schreibt sich Nachhaltigkeit, Ökologie und Ökonomie auf die Fahne, legt Wert auf bürgerliches Engagement und nicht zuletzt: kulturelle und politische Mitgestaltung. Ein Stadtlabor für Utopien eben.


Der dringenden Bedarf an Menschen, die sich ehrenamtlich für unsere Zukunft engagieren, wird insbesondere dann sehr deutlich, wenn wir uns die vermeintlichen Utopien der heutigen Zeit anschauen: beispielsweise jene der Wirtschaft, des kalifornischen Silicon Valley, das drauf und dran ist, die Industrielle Revolution in den fünften Akt zu befördern, wobei noch nicht ganz entschieden ist, ob es sich um ein Drama oder eine Komödie handelt. Oder den ganz offensichtlichen Mangel an Utopien in der Politik, die vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht und eben diesen kurzerhand abholzt.
Und während wir, als Folge der rasenden Geschwindigkeit, mit der die Erde in diesen Tagen rotiert, in eine eigenartige Schockstarre fallen, packen die Wuppertaler es an. Bemerkenswert. Utopien sind vielleicht wichtiger denn je, denn nehmen wir das Träumen nicht in die Hand, geben andere die Richtung vor, und im Nachhinein beschweren nicht nur zwecklos, sondern fahrlässig.
Also los geht’s: Suchen Sie sich gefälligst Ihre eigene Utopie!