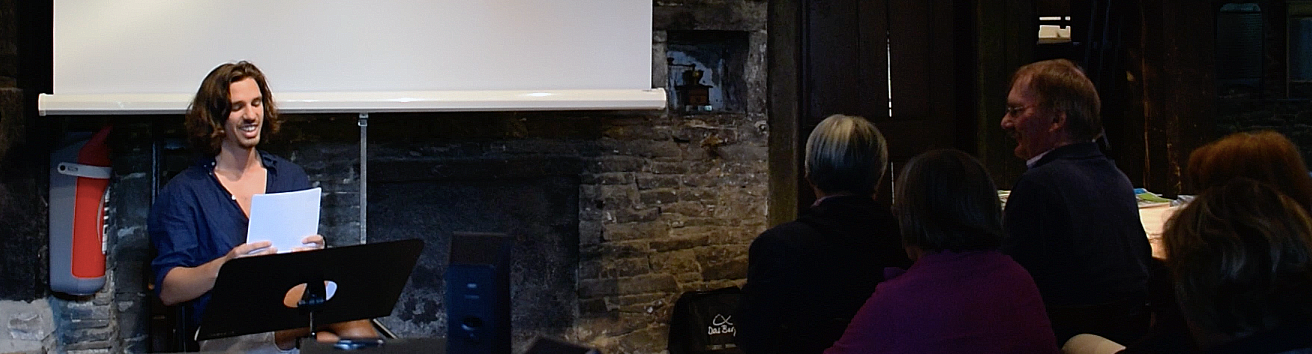Game of S.K.A.T.E
27. Juli 2017
«SKATE», nennt sich die Königsdisziplin des Duells auf dem Skateboard. Bei diesem Wettbewerb macht einer der beiden Teilnehmer einen Trick vor, der andere bekommt danach die Chance, diesen zu wiederholen. Schafft er es nicht, bekommt er einen Buchstaben. Zuerst das S, beim nächsten Scheitern das K, und so weiter, bis das Wort «Skate» ausgeschrieben ist. Insgesamt darf man sich also vier Fehler erlauben, beim fünften bekommt man noch eine zweite Chance, mit dem sechsten hat man verloren.
«Man fährt nicht gegeneinander, höchstens gegen sich selbst», sagt Sven Spierling-Meine, der Organisator des Skatecontests, welcher im Skatepark Stadtwald in Mettmann an einem Samstagnachmittag mal im Regen, mal unter Sonnenschein stattfindet.
Sven, selbst Skater seit seiner Jugend, arbeitet für das örtliche Jugendamt und genießt die Abwechslung des regulären Arbeitsalltags sichtlich.
Dieses Miteinander, welches Sven beschreibt, wird auch dem Laien sofort ersichtlich. Schafft einer den Trick nicht, wird er vom Gegner, Pardon, dem «Mit-Skater», sofort unter Applaus aufgemuntert, ein Raunen geht durch die Reihen, man freut und ärgert sich gemeinsam. Umso schöner ist es, wenn sich ein Duell zuspitzt, beide Skater hoch konzentriert sind und einander wieder und wieder übertreffen; es folgt stets frenetischer Jubel von allen Seiten.
Konzentration ist beim Skaten ein treffendes Stichwort, denn neben der körperlichen Leistungsfähigkeit, spielt sich dieser Nischensport vor allem im Kopf ab. Genauer: Im Frontallappen. Dieser Bereich des Gehirns, der grob gesagt hinter der Stirn liegt und den Säugetieren vorbehalten ist, nimmt unter anderem eine zentrale Rolle in Bereichen der Emotionsregulation, der Planung motorischer Abläufe, der Gedächtnisintegration, aber auch der Persönlichkeit und des Sozialverhaltens ein. Ferner wird diesem Hirnareal eine Wechselwirkung mit Achtsamkeit attestiert, welche unserer Entwicklung und dem Wohlbefinden dienlich, vielleicht unabdingbar ist.
In einer psychologischen Studie versuchten zwei Forscher von der Memorial Universität in Kanada (Seifert & Hedderson, 2009) eine Verbindung zwischen dem Skateboarden und der intrinsischen Motivation, sowie dem Zustand des «Flows» herzustellen. Ein jeder kennt das erfüllenden Gefühl des Flows, welches sich durch völlige Vertiefung und dem Aufgehen in einer Tätigkeit definiert. Der Studie zufolge stellte das Skaten bei den befragten und beobachteten Skatern eine Möglichkeit dar, selbst gesteckte Ziele auch unter Widrigkeiten und Rückschlägen zu verfolgen, dabei die Konzentration zu erhöhen und den Fokus der Aufmerksamkeit zu verringern. Diese Tätigkeiten führten zu intensiven Episoden der Flow-Erfahrung und böten eine emotionale Grundlage für den Erhalt von intrinsicher Motivation. Skater berichteten über das Erleben von Freiheit, Autonomie, Herausforderung und Erfolg.
Klingt das in Anbetracht unseres Alltagswahnsinns und der dazugehörigen Portion Informationsüberflutung nicht einfach nur traumhaft?
Soviel zur Wissenschaft hinter dem Board, doch woher kommt dieses Skaten überhaupt? Zu Beginn der 50er Jahre suchten findige Surfer in Kalifornien eine passende Alternative bei zu geringem Wellengang. Daraufhin packten diese ganz einfach Rollschuhrollen (roller skate wheels) unter Bretter, das sogenannte «Bordstein Surfen» war geboren und entwickelte sich bald zu einem eigenen, auf der ganzen Welt gefeierten Sport unter neuem Namen: Skateboarding.

Auch die Geschichte des Wettbewerbs «SKATE» hat seine Historie. Bevor ein jeder sich die Tricks und Kniffe im Internet anschauen konnte, war dies nicht nur ein Messen der Fähigkeiten, sondern mehr noch ein Austausch an theoretischem und praktischem Wissen. Man lernt schließlich voneinander. Heute findet man eine schier unendliche Bandbreite an sogenannten Skate-Tutorials, also Kanälen im Internet, welche eigens darauf spezialisiert sind, die Theorie des Skatens zu vermitteln. Die Theorie. Auf dem Brett stehen und «Bordstein Surfen» muss man immer noch analog und der Lernerfolg mit Freunden auf der Straße ist zum Besserwerden unerlässlich, da kann man noch so viel im unendlichen Internet surfen.
Und das ist es auch, was an diesem Samstagnachmittag am meisten imponiert. In einer Welt der Bildschirme trifft man hier auf junge, sportliche Menschen, die ein Miteinander pflegen und leben. Auch die älteren, zunächst verdutzten Zuschauer, welche sich heute zum Skateplatz verirren, merken sofort, dass diese Freude und dieses Lebensgefühl einen schönen Kontrast zu den im Mobilfunktelefon vergrabenen Köpfen ergibt.
Ganz abgesehen von den zahlreichen Blessuren und gröberen Verletzungen, die bei extremer Ausführung, dies sei nicht unerwähnt, mit dem Skaten einhergehen, ist dies ein Training für den ganzen Körper. Rutscht einmal ein T-Shirt nach oben, oder wirft man einen Blick auf jene Burschen, die ohnehin oberkörperfrei unterwegs sind, muss man sich sofort entscheiden, vor Neid zu erblassen oder anerkennend den Kopf zu schütteln. Nun gut, wahrscheinlich beides.
Und so rollt der Tag im Mettmanner Skatepark dem Abend entgegen, mit ihm junge Männer auf Brettern, die lachen, schwitzen, fallen und aufstehen, die mit sich und miteinander in Kontakt stehen und bei all dem auch noch unglaublich cool aussehen.
Glauben Sie daran, dass es nie zu spät ist, etwas Neues zu beginnen? Neal Unger ist 60 Jahre alt und bezeichnet sich selbst als einen Anfänger. Und eines steht fest. Wenn Sie mit einem Board im Skatepark Stadtwald in Mettmann auftauchen, treffen Sie auf junge Leute, die sich freuen werden die Leidenschaft für das Skateboarden mit Ihnen zu teilen.
Ihr Körper und Geist werden es Ihnen danken.