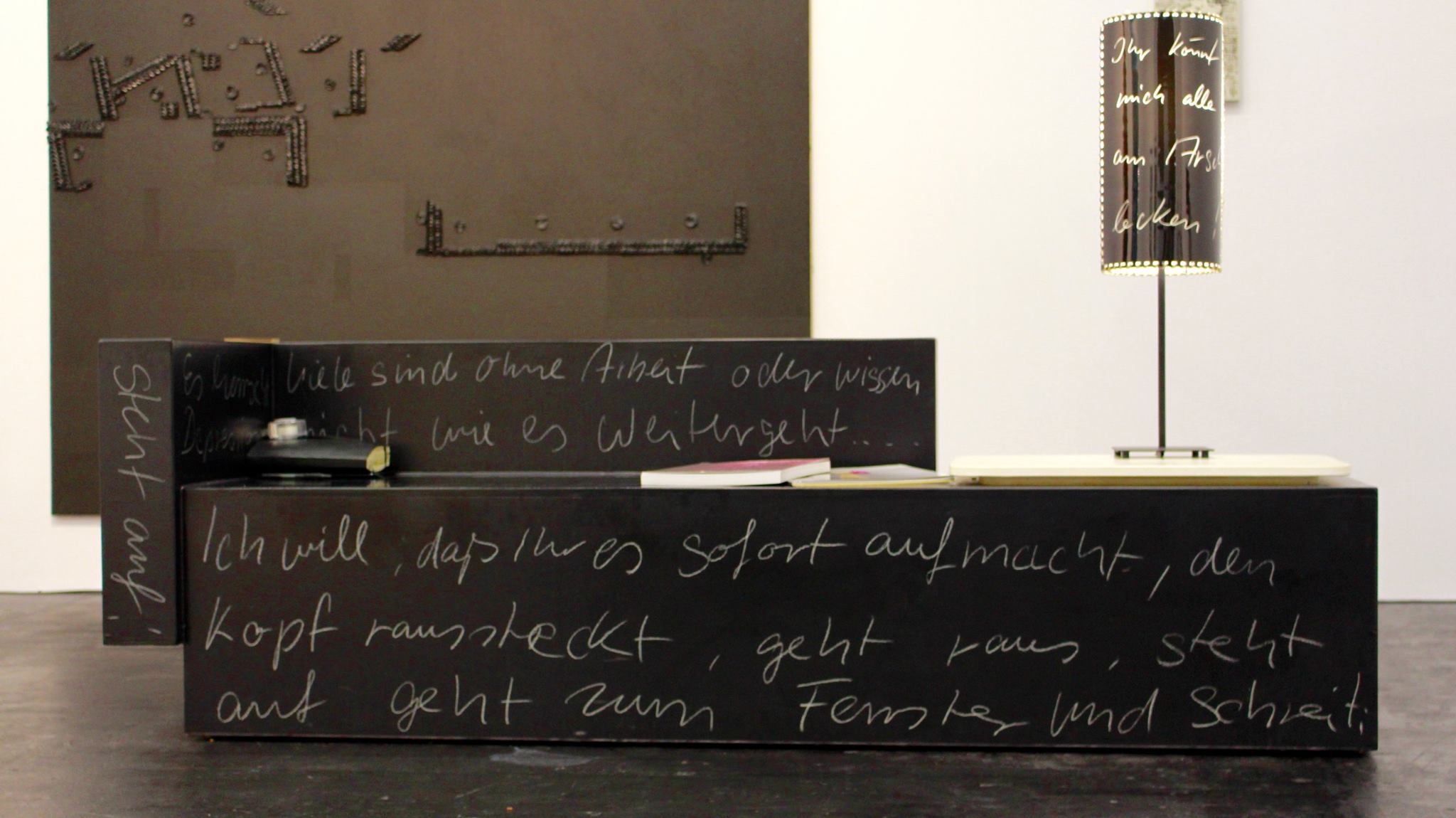Im Spiegel – Träume & Albträume einer Stadt
24. Juli 2017
Zwei Männer, zwei Gegenpole einer Stadt. Die Stadt, eine ungerechte Mutter, hat dem einem alles gegeben, dem anderen alles genommen. So schien es mir erstmals.
Ich bin neu in Aachen. Mein erster Spaziergang geht durch die engen Gassen der Stadt, die mich, eine Fremde, ausgesucht hat, sie und ihre Region auf meine schräge Weise zu sehen und zu vermessen.
Mein Blick hüpft hin und her. An einer Fassade hängt ein in tiefen Gedanken versunkener Steinkopf. Ich nicke ihm zu und jage weiter die gepflasterte Straße entlang in Richtung des imposanten Gotteshauses im Herzen der Stadt. Die grauen Töne am Horizont überdecken die Sonnenstrahlen und spucken die ersten Regentropfen aus, die mitten auf meiner Stirn landen. Ich suche Schutz und lasse mich von einem geräumigen Feinkostladen mit großen Fensterscheiben und kleinen Leckereien in der Glasvitrine, kleinen Teigversprechungen in vier Variationen, verführen.

Als ich die Tür öffne, springt eine Mittdreißigerin mit kurzem Haarschnitt und zerknittertem dunklem Leinenanzug vom Stuhl auf. Ihr Blick wandert unruhig über die Straße, die gerade mit dicken Regentropfen gegossen wird. Sie zieht ihren kleinen Regenschirm aus der Tasche und küsst den Ladenchef zum Abschied auf die Wange. Er, gepflegter Vollbart und seidiges Haar in einen Dutt feingebunden, hält seinen Kopf so gerade, als ob zehn Kameras auf ihn gerichtet wären. Mit feinen, fast mädchenhaften Gesichtszügen und der dünnen blasen Haut wirkt er auf mich wie eine Trend-Wachsfigur aus dem Museum von Madam Tussaud. Als sein weibliches Pendant, die Kurzhaarige, die Tür hinter sich schließt, widmet er sich sofort mir. Selbstverständlich darf ich mich an den selben Stehtisch hinsetzten, den einzigen im Laden, an dem er kurz davor mit meiner Vorgängerin am Fenster saß.
Meine Augen kleben an der Glasvitrine mit den kleinen französischen Teilchen.
„Petit fours“… sagt er mit der Betonung auf der letzten Silbe.
„Meine eigenen Variationen“ fügt er stolz hinzu. Meine Zunge kreist um meine Lippen. Ich bestelle das Stück mit frischem Ziegenkäse und dem Feigenmus. Beide Geschmäcker in einem so kleinen Stück zu kosten, lässt mich vor Vorfreude auf dem Stuhl hin und her rutschen. Dazu eine rosa Limonade aus Belgien, Holunder mit kaum Zucker: Göttlich.
Der Chef, die graziöse Eleganz in Person, serviert mir das Teilchen auf einem alten, gemusterten Goldrandteller. Ich fühle mich wie eine Auserwählte.
Seine Mini- Ziegen-Feige-Leckerei, die vor mir auf dem dünnen vergoldeten Teller wie ein Bild liegt, traue ich mich kaum anzubeißen. Mit der Zier-Gabel seziere ich das Stückchen und lasse kleine Partikel in meinem Mund langsam zergehen. Das Teilchen wirkt wie Homöopathie. Meine Zunge spürt keine Ziege oder Feige mehr, sondern nur noch seinen Stolz, seinen Stil, seine Muße. Hier könnte ich genüsslich abnehmen, schießt es mir durch den Kopf. Nix verschlingen, sondern kleine Bisse verschmelzen lassen, sie gaanz laaaange kauen …
Daniels Traum
Er steht vor mir wie ein Held auf der Bühne, sein Kopf leicht seitlich gebeugt, studiert meine Reaktion. Die ist üppig. Ich schnalze und schmelze vor Genuss.
Mein Blick wandert über die Wände und studiere den Rest seiner in den Vitrinen aus feinen Holz bis zur hohen Decke gestapelten Produkte. An zwei Wänden in groben Holzvitrinen wie Museums-Exponate präsentiert: sechs Käsesorten, Wurst, Wein, Marmeladen… fein drapiert mit handgeschriebenen Etiketten und mit stolzen Preisen geschmückt.

Er scheint mit sich und der Welt völlig stimmig zu sein. Alles sitzt an ihm. Sein Geschäft, eine Bühne, die Mischung aus hip und bieder, Feinkostladen, Café, Traumfabrik, sein Werk. Alles seine Ideen und natürlich seine Handarbeit. Meine Neugier für die „One-Man-Show“ des um die dreißig Jahre jungen Unternehmers geht langsam in Bewunderung über. Das spürt er und wird gesprächig.
Seine Bärlauch-Butter und alle Pestos mache er immer selber, sagt er… Nach alten, guten Rezepten seiner belgischen Großmutter, die heute noch ein kleines Restaurant besitzt. Seinen Geheimort in einem schattigen Busch im nahliegenden Stadtwald, in dem „sein Bärlauch“ wächst, hat leider ein Obdachloser entdeckt. Der reisse sogar die Wurzeln raus, beschwert er sich empört.
Ich schmunzle. Auch meine Kölner Nachbarin kämpft jedes Frühjahr gegen eine Schar Koreaner, die sich an „ihrem“ Bärlauch vergehen. Und ich nehme den Türken aus der Kölner Südstadt sehr übel, dass sie mir jedes Jahr in „meinem“ Nippeser Tälchen Walnüsse vor der Nase wegpflücken.
Er lacht. Seine Zähne glänzen wie Perlen.
Alle seine Produkte, ob Bärlauch-Butter, Orangen-oder Feigenmarmelade stehen unter einem Label.
„Daniel heißt es“, sagt er, „wie ich“.
Er verkaufe sie jetzt auch im Internet. Weltweit. Geschäftlich sei er analog und digital, lokal und global unterwegs. Er sei eine Art „Taste -Botschafter seiner Heimat“. Belgien in Deutschland.
„Ach was?“ Ich bin irritiert. Mein erster Aachener Feinkostgastronom ein Belgier? Sein Deutsch klingt einwandfrei. Akzentfrei. Er lächelt. Seit 10 Jahren lebe er in Deutschland und habe seinen Akzent inzwischen abtrainiert. Vielleicht weil er von Anfang an in der Gastronomie gearbeitet habe und überwiegend Deutsch spräche. Nun sei er seit einem Jahr sein eigener Chef.
Ich bin beeindruckt. Und ein bisschen neidisch. Er imponiert mir und stellt mich in Frage. ‚Was wäre mein Traum’, frage ich mich. Warum bin ich meinem Balkan-Akzent nach fast einen Vierteljahrhundert so hartnäckig treu geblieben? Um mit meinem ewig rollenden „rrrr“ und dem im Gurgel steckend gebliebenen „llll“ einheimische Ohren zu kratzen? Ich liebe gutes Essen, komme auch aus einer Gastronomen-Familie, aber beim Kochen werden meine beiden Hände links. Obwohl ich die besten Köche der Welt immer um mich hatte. Vielleicht deswegen?
Und während sich sein Ziegen-Feigen-Teilchen in meinen Magen bequem verteilen, erkämpft die Sonne wieder den Horizont. Bevor ich mich von dem stolzen Belgier verabschiede, der in Aachen, der deutschen Grenzstadt, seinen Traum lebt, kaufe ich noch eine sündhaftere teure Orangenmarmelade in einem Miniglas verpackt. Mein deutscher Mann wird sich freuen.
Toms Alptraum
Ich finde mich in den fremden Städten schnell zurecht. Leichter Gang, große Augen, verträumt.. „Leichte Beute!“, würde meine Mutter sagen. Und tatsächlich. Kaum habe ich mich fünf Schritte von einem belgischen Traum entfernt, sprich mich ein anderer Mann an. Sein Name ist Tom und er sucht eine Übernachtungsmöglichkeit.
Seine Augen sind ruhig und fragend, sein Bart dicht und so ordentlich gekämmt als ob er an seinem mageren Gesicht und an den dünnen Hals geklebt wäre. Er spricht leise, ich spitze meine Ohren, ich verstehe nur ein Wort:
«Herberge».
Ein altmodisches deutsches Wort, denke ich mir, das nach Armut und Knappheit riecht. Oder doch ein Retrowort aus der Hipster-Welt so wie „Heimathirsch“, „Hornochse“, „Fette Kuh“, „Dicker Hund?“, Namen der neuen Läden, die um mich herum wie die Pilze wachsen.
„Herberge“ – das Wort hat mit dem Partikel «her» und dem Nomen «Berg» wenig zu tun, oder vielleicht doch?
Den Mann hat gute Manieren, einen feinen Sprachduktus und coole Klamotten. Sein Karo-Hemd, seine braune Hose, alles sauber, gebügelt und solide. Er ist mager, seine dunklen Augen blicken unruhig.
‚Ein Hipster-Veganer vielleicht?’ schießt es mir durch den Kopf. So wie mein Neffe aus Berlin, der gerade sein Sieben-Tage-Hunger -Experiment beendet hat, um seinen Willen zu stärken und die Kontrolle über seinen 60 kg- Körper noch ein Stück mehr zu beherrschen.
„Ich bin hier neu. Mein erster Tag in Aachen!“ höre ich mich sagen. Es klingt wie die Offenbarung einer Kontaktsuchenden und als Entschuldigung zugleich.
„Ich weiß wirklich nicht, wo Sie hier eine ‚Her…berge’ finden könnten. Aber es gibt bestimmt ein günstiges Hostel in der Nähe oder eine andere Übernachtungsmöglichkeit… Warten Sie, der Mann hier im Laden kann Ihnen bestimmt besser helfen …“

Ich drehe mich um und sehe hinter der großen Fensterscheibe Daniel, den Belgier, der in seinem Traumladen meinen leeren Teller gerade aufräumt.
„Neeein!“ wehrt der Mann mit dem dichten Bart meinem offensichtlichen voreiligen Ratschlag ab.
„Sie haben mich, glaube ich, nicht verstanden…Wo eine Herberge hier zu finden ist, weiß ich zu gut, leider fehlt mir das Geld… und wenn Sie so nett wären.. mich mit ein paar Groschen zu unterstützen…wäre ich Ihnen sehr dankbar.“ Die Worte sprach der dürre Mann noch leiser, beugte sich dabei wie verschämt ein Tick weiter nach unten.
Ich bin überrascht.
‚Hat ihm vielleicht jemand das Geld gestohlen?’ fragte ich mich. Die Aufmerksamkeit nimmt nämlich ab, wenn man mit einem leeren Magen kämpfen muss. Als ich einmal fasten wollte, hörte ich unterwegs plötzlich meine Großmutter, die nach saftigen Fleisch schrie, und habe meine Handtasche verloren. Die Stadtdiebe warten auf Naive, Abwesende, Zerstreute und die, die sich selbst bestrafen.
„Also Sie brauchen Geld? Wie sind Sie in diese Situation gekommen, wenn ich fragen darf?“
Fremde Menschen um Hilfe zu bitten, stelle mir nicht so einfach vor. Meine direkten Fragen, ohne lange um den heißen Brei zu kreisen, überraschen mich gar nicht mehr. Ein Neuling in der Stadt hat die Narrenfreiheit, darf wie ein Kind die Welt mit seinem «Warum» nerven. Tom und ich müssen uns nichts vorspielen. Als Aliens, die nicht dazugehören, dürfen wir die ganze Wahrheit schneller erfahren.
„Wollen Sie das wirklich wissen?“ fragt er.
„Und wie! Vor allem, weil ich Sie überhaupt nicht mit einem Bettler in Verbindung bringen kann.“
„Ich bin kein Bettler“ wehrt sich mein Gegenüber. „Ich spreche nur manchmal Menschen an, wenn ich glaube, sie würden mir vielleicht helfen wollen…“
„…ein Liebesdrama!“ sagt er nach einer kleine Pause, kratzt sich am Kopf, sein Blick schwebt über die Dächer. Er sei zwischen Weihnachten und Silvester vor seiner Ehefrau geflüchtet. Zuerst fand er Zuflucht bei seinen Freunden, nun wohnt er seit vier Monaten im Wald. In einem Zelt, am Rande der Stadt. Er versuche verzweifelt, wieder „die Kurve zu kriegen“. Einmal in der Woche dürfe er sich bei einem Priester duschen und die Klamotten waschen. Und wenn es ihm ganz schlecht gehe, sammele er Geld für die Herberge.
„Was ist passiert? Warum sind Sie von ihrer Frau geflüchtet? Und ausgerechnet mitten im Winter?“ frage ich wie eine Psychologin. Ich spüre wie mich seine Geschichte packt.
„Warum wollen Sie das alles wissen?“ fragt Tom.
„Weil das jedem passieren kann. Und weil ich das verstehen will. Und ich sie sympathisch finde.“ sage ich.
„O.K.“ sagt Tom.
Tom und seine Frau seien 17 Jahren eine Paar gewesen. Beide in Duisburg geboren und aufgewachsen. Vor drei Jahren hätten sie geheiratet und nach Aachen gezogen. Sie fanden in Aachen eine Wohnung und Jobs; er als Dachdecker, sie als Verkäuferin. Die Armut in Ruhgebiet dachten sie, für immer hinter sich gelassen zu haben. Doch der Winter hieß Kurzarbeit, er blieb zu Hause. Den letzten Herbst verlor auch sie ihren Job. Das Geld wurde knapp. Sie begannen sich zu zanken. Und das sei immer schlimmer geworden. Und es habe nicht aufgehört…
„Es gab keine andere Chance…als Fliehen…und das ist gut so.“
„Haben Sie Familie? Eltern? Geschwister, jemanden, der Ihnen helfen kann?“ frage ich weiter und überlege, was würde ich tun, wenn ich als Frau, als ausländische Frau dazu, in so einer Situation kommen würde. Ich würde meine Geschwister anrufen. Auch wenn wir uns seit Jahren zanken und immer seltener am gleichen Strick zeihen, würde ich sie um Hilfe bieten.
Seine Eltern seien beide tot und sein Bruder lebe weit weg, in Berlin. Sozialhilfeempfänger. Und auch wenn er in Aachen leben würde und einen guten Job hätte, würde er ihn nicht belästigen.
„Wir waren uns nie so nah…“ sagte er trocken.
„Ich verstehe…“
„Warum nicht zum Onkel Hartz gehen“, frage ich?
„Ich meine Hartz Vier? Deutschland ist Gott sei dank ein Sozialstaat. Keiner muss auf der Straße leben. Auch nicht im Wald leben. In einem Zelt. Wie auch immer?“
„Nein. Das will ich nicht. Das wollte ich nie. Aber es ist dazu gekommen“ sagt er geduldig. Seine Augen sehen sehr müde aus. Die Bürokratie in Deutschland sei hart:
„Harz IV ist für die Robusten, wissen Sie.“ meint er. Er gehöre leider nicht dazu. Er habe versucht eine Wohnung in Aachen zu bekommen, aber das scheint schwieriger zu sein als „einen Sechser im Lotto zu treffen“. Die Wohnungen, die Harz IV bereit wäre zu zahlen, gibt es in Aachen gar nicht mehr. Und ohne einen Job sei es praktisch unmöglich. Um einen Job wiederum zu bekommen, brauche er zuerst eine Adresse. Die er jetzt nicht habe, erklärt er mir und schaut mich so an, als ob er Mitleid mit mir hätte.
Langsam verstehe ich Tom und ich beginne mich, zu schämen, ihn mit so vielen Fragen belästigt zu haben. Doch eine Frage habe ich noch:
„Sie haben etwas erlebt, wovor jeder Angst hat: die Obdachlosigkeit. Sie sind, wissen Sie, uns allen jetzt ein Stück im Voraus. Jetzt wissen Sie, wie die Menschen wirklich sind. Wie die Menschen ticken, wenn sie ihre Masken abziehen, wenn Sie vor ihnen stehen, und sie nach Geld fragen?“
„Die Menschen sind mit oder ohne Masken gleich. Sie denken in Schubladen und urteilen schnell und moralisch. Manche beschimpfen mich, ich sei drogenabhängig, ein Alkoholiker, Lügner oder was auch immer. Manche bespucken oder verjagen mich und wollen mich treten und schlagen. Es gibt aber auch manche, die bereit sind mich mit ein paar Groschen zu unterstützen.“
„Die können dann aber die Schlimmsten sein. Die wollen alles ganz genau wissen… können gar nicht aufhören mit ihrer Fragerei… eine Qual …“
Meine Fragen sind um. Mein Blick klebt am Boden. Ich fühle mich ertappt und bin konfrontiert mit der Arroganz des Betrachtens.
‚Was mache ich hier, eigentlich?_ frage ich mich . ‚Wer bin ich überhaupt, um so unverblümt die Menschen auszufragen, in ihrem Schmerz, Traum oder Albtraum einzudringen? Sie beobachten, ihnen diese direkten Fragen zu stellen? Darf man das?’
Tom, der seinen Albtraum mit erhobenem Kopf wie Prometheus lebt, der den Götter Licht geklaut haben, um den Menschen Wahrheit zu schenken, hatte mich angesprochen, weil er eine Bleibe suchte und mich auf den Boden geholt. Für mich, in meiner Entdeckereuphorie war er ein Studienobjekt wie der Feinkost- Schönling aus dem Hipster Laden mitten in der Stadt.
Die Schreiberin hat sie beide unter die Lupe genommen wie Touristen die einheimische Aborigines im Busch.
Bevor ich meinen Blick von Boden erhebe, überlege noch kurz, was ich Tom geben soll… Einen Schein, 5er oder auch 10er hatte er bei mir längst verdient, ich befürchte aber, er könnte es als meine Überheblichkeit oder als mein Schuldgefühl verstehen. Ich bin eitel, und dazu die Enkelin meines Opas. Als der Schlitzohr sein eigenes Restaurant in damaligen Jugoslawien betrieb, stellte er uns Enkelkinder oft vor einer schweren Wahl, entweder das kleine Schein oder so viel Minimünzen aus einer dünnen Vase mit einer Hand zu greifen.. Ich will dem armen Tom in Ruhe lassen, wühle kurz in meinen Geldbeutel, drehe ihn um, bis die ganzen Münzen auf seine Hand fallen..
„Mach et juuut!“ verstecke ich meine Unsicherheit hinter dem lustigen kölschen Gruß.
„Du auch!“ sagt Tom, wirft einen kritischen Blick auf seinen Handfläche auf der meine Münzen als Zeugen der Peinlichkeit unserer kurzen Begegnung liegen, lässt sie klingend in die Hosentaschen gleiten, hängt seinen schweren Rucksack über den dürren Rücken und biegt mit schwerem Schritt in eine enge Gasse links. Ich drehe mich um, schwitze…

Ich nehme die umgekehrte Richtung, marschiere auf die schöne Aachener Kathedrale zu. Von einer seitlichen Fassade glotzt mich nun ein goldener Heilige mit dem Kreuz in einer Hand und dem Feder in der anderen? Als ob er fragen würde:
„Na, Alien, wo geht die Reise jetzt hin…?“