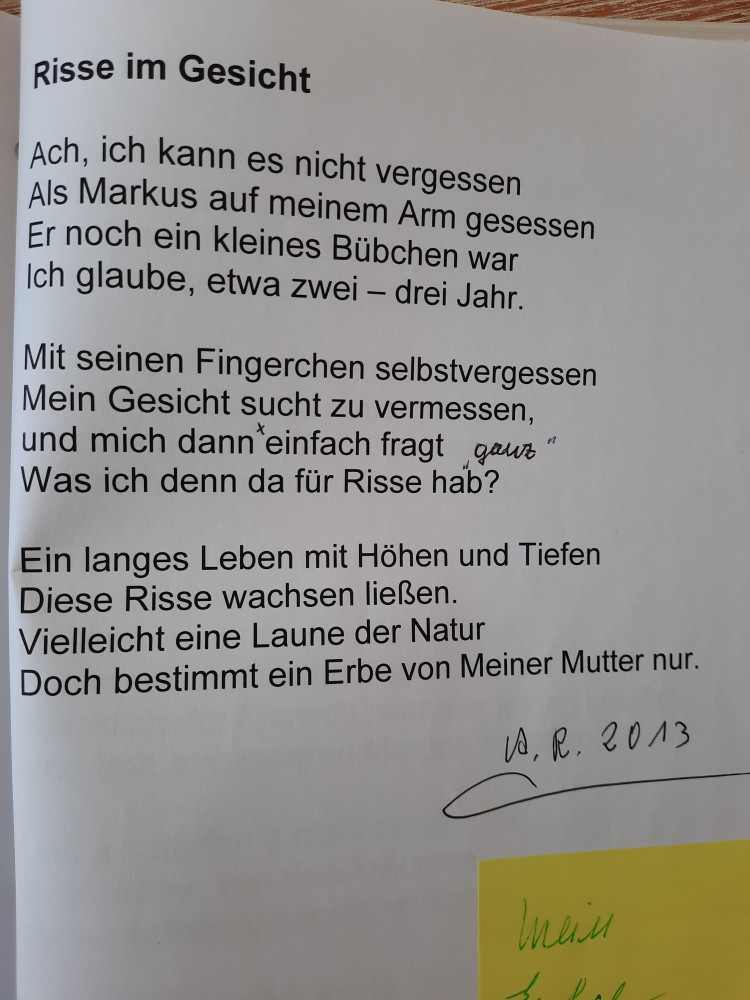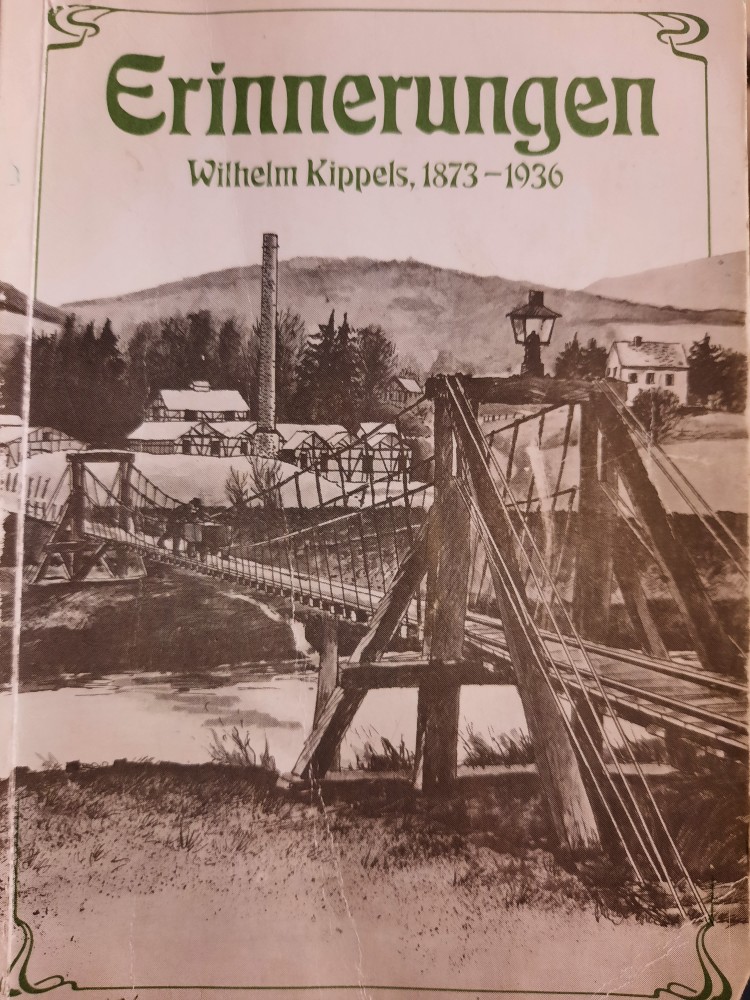Ich möchte mich nicht vergessen
9. Juni 2022
Alfred ist ein Kundschafter, sagt Tina und ruft: Alfred! Alfred bleibt zwar stehen, aber ohne sich umzudrehen. Er hat die Aufgabe, vorne zu sein und zu gucken, sagt Tina.
Alfred ist ein Therapiehund. Tina setzt ihn ein, wenn sie zu ihren Patienten ins Pflegeheim geht; die Patienten lieben ihn. Nicht, weil er so verschmust ist, das ist offenbar nur meine eigene Vorstellung von einem Therapiehund. Sondern, erklärt mir Tina, weil er so geduldig ist. Und weil ich anhand seines Verhaltens Dinge erklären kann.
Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel komme ich mit Alfred ins Patientenzimmer. Alfred beachtet den Patienten gar nicht, sondern schaut aus dem Fenster. Typisch, sagt der Patient. Für mich interessiert sich niemand, nicht einmal ein Hund.
Vielleicht liegt es ja gar nicht an Ihnen, sage ich dann. Vielleicht liegt es daran, dass sich ein Hund zunächst einmal für die Vorgänge da draußen interessiert. Viele Patienten erkennen dann, dass jeder eine eigene Perspektive hat. Selbst ein Hund. Und umso mehr freuen sie sich dann, wenn Alfred sich streicheln lässt, das mag er nämlich auch gerne.
Für den Spaziergang mit Tina habe ich die Straße der Arbeit verlassen, wir gehen durchs Neandertal wie auf einem endlos grünen Teppich aus Wald und Wiese und sprechen über ihren „seltsamen“ Karriereweg. Sie kommt aus der Nähe von Bad Münstereifel, und hatte überhaupt keinen Plan, was sie mal werden wollte. Das war die Zeit, in der man Frauen in Männerberufe holen wollte, da sagte mein Lehrer, dat wär doch wat für dich, Tina. Ja, dat wär was für mich, – aber mehr aus dem Stolz heraus, das er mich da drin gesehen hat, schiebt sie hinterher; und in ihrer Stimme schwingt dieser Stolz noch immer mit, aber auch die Distanz der Jahre und wie sie ihr jüngeres Ich ein bisschen belächelt, auf eine freundliche Art.
Wieso denn nicht die große weite Welt?
Sie kommt aus einer Handwerkerfamilie und das Burschikose des Handwerks strahlt auch Tina aus. Zunächst hat sie bei einem Bauschreiner ein Praktikum gemacht, aber das war mit harter, körperlicher Arbeit verbunden, mit sehr viel schwerem Tragen. Also half sie lieber beim väterlichen Betrieb mit, der auf das Bauen von Gartenhäusern spezialisiert war, sie strich die Häuschen an und suchte sich dann einen Ausbildungsbetrieb in der Nähe. Einen, den ich mit dem Mofa erreichen konnte. Das Praktische stand im Vordergrund.


In Bad Münstereifel ist sie immer an einem Reisebüro vorbeigelaufen, da hätte ich gerne gearbeitet, aber das hätte ich mir nie zugetraut. Ich komme vom Dorf, was soll ich da den Leuten erzählen von der großen weiten Welt?, ruft ihr jüngeres Ich, das die Antwort schon weiß, und Alfred, der die Antwort noch nicht weiß, dreht sich um zu uns und schaut erstaunt: Wieso denn nicht die große weite Welt?
Bleib lieber bei dem, was du dir zutraust, sagte Tina sich und schloss ihre Ausbildung als Anstreicherin ab. In den zwei Jahren, die ich dort gelernt habe, hatte ich jeden Montag eine Magenschleimhautentzündung. Jeden Montag morgen war mir schlecht, weil ich mich wieder mit dem Meister auseinandersetzen musste. Der war nicht bösartig, aber er wollte mich erziehen. Wie man richtig zu sein hat. Zum Beispiel, dass man nicht reden darf auf der Arbeit. Ich hatte mal eine Suppenterrine dabei und die Leute nach heißen Wasser gefragt, für so etwas habe ich sofort eins auf den Deckel bekommen. Ich sollte möglichst unsichtbar sein.
Alfred komm, ruft Tina und wir biegen ab und laufen in ein Dorf, von dem ich später, als ich den Text schreibe, keine Ahnung mehr habe, wie es dort ausgesehen hat. Tina und Alfred kennen den Weg, in meiner Erinnerung gehen wir eine lange Schleife und überall duftete es nach Blumen, Gras und Moos. Und nach Hund, denn als wir Pause machen, darf ich Alfred streicheln und mit beiden Händen fest in sein dichtes Fell greifen und ihn kraulen. Er lehnt sich an mein Bein und lässt seine Zunge aus dem Maul baumeln.
Das Kind im Brunnen
Mein damaliger Freund studierte Maschinenbau in Aachen, also saß ich da mit dem Studienbuch und dachte, was studierst du denn jetzt? Bei Sozialarbeit blieb sie hängen, das Fach erschien ihr machbar, wie Tina sagt. Warst du die erste in der Familie, die studiert hat?, frage ich. Ja klar, sagt Tina und beschreibt, wie sie sich im Sekretariat anmeldete und schon bei der Frage: Sozialarbeit oder Sozialpädagogik überfordert war. Wo ist denn der Unterschied? Und bekam zur Antwort: Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, stehen die Sozialpädagogen herum und fragen, wie konnte das nur passieren? Die Sozialarbeiter fragen, wie kriegen wir das Kind wieder heraus.
Sie entschied sich für Sozialarbeit.
Wir lachen.
Nach dem Studium fing sie in einem Wohnheim für psychisch erkrankte Menschen an, und da war ich total erstaunt, wie meine Kolleginnen sich über Menschen austauschten. Wie sie über Methoden und theoretische Behandlungsansätze sprachen. Es reichte nicht, Sozialarbeiterin zu sein, man musste sich auch so verhalten! Das war mir vollkommen fremd, diese Erkenntnisse hatte das Studium in mir nicht hervorgerufen. In Psychologie hatte sie einen Professor, der tiefenpsychologisch gearbeitet hat – auch mit uns Studentinnen und der hat einfach bei jeder Frau vorausgesetzt, dass es da etwas gibt in ihrer Kindheit, wovon sie nichts weiß. Dass da was mit euch passiert ist, das ihr gar nicht wisst! Da kommst du, sagt Tina, als ungepelltes Ei natürlich ins Grübeln, wer könnte das gewesen sein, wer könnte mir etwas angetan haben? Natürlich hat es auch bei einigen gestimmt, denn die Wahrscheinlichkeit ist schon recht hoch, dass eine Frau Missbrauch oder andere Gewalt erfahren hat. Mir aber hat es ein schlechtes Gewissen gemacht, als würde ich keine Verantwortung übernehmen wollen, für das, was mir vermeintlich passiert ist.






Trotz aller vermuteten Unzulänglichkeit stellte sie bald fest, dass sie mit ihren Patient:innen sehr gut zurecht kommt und schnell Zugang zu ihnen hat.
Wahrscheinlich, sagt Tina, weil nicht alles, was mir erzählt wurde, gleich eine Methode nach sich zog.
Sie hat, denke ich beim Abhören der Aufnahmen, die Fähigkeit, Ironie so zu verpacken, dass es sich absolut nicht ironisch anhört. Man könnte auch sagen, sie verzichtet auf die Methoden der Ironie, sie ist es einfach.
Eigentlich ist der Mensch immer falsch
Mit ihrem Mann ist sie schließlich nach Mettmann gezogen, wo sie in der Tagespflege für Psychisch Erkrankte arbeitete. Da ging es vor allem darum, dass die Leute in eine Tagesstruktur kommen und nicht wieder in eine Depression verfallen. Sie vielleicht sogar wieder fit für den Arbeitsmarkt werden. Dass sie sich überhaupt wieder als wertvolle Menschen fühlen, obwohl sie ja dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist nämlich stark miteinander gekoppelt. Es ist Wahnsinn, sagt Tina, wie schnell du aus so einem Rasterleben heraus auf eine schwarze Seite fällst, wenn du nicht mehr genügst.
Wir gehen über ein offenes Feld, ich höre den Wind, der ins Mikro pfeift. Bei den Bewerbungstrainings wird einem vermittelt, dass es an einem selbst liegt, wenn man keinen Job bekommt. Wenn du so und so auf dem Stuhl sitzt, dann wird das nix. Eigentlich ist der Mensch immer falsch, deshalb musst du ihn formen, dann ist er richtig!
Es heißt ja immer Psychisch Kranke, aber das ist eigentlich falsch. Sie sind ja nur er-krankt, vorübergehend erkrankt. Dann lassen wir sie halt mal so, wie sie jetzt gerade sind! Sie hat zum Beispiel im Sommer Weihnachtslieder abspielen lassen, um den Besucher:innen zu zeigen: Verrückte Zeiten. Nicht bekloppt, nur verrückt! Da ist sie wieder, denke ich begeistert, diese sehr spezielle ironiefreie Ironie.
Es ist wichtig, dass ich mit dabei bin
Alfred, der Saunickel, ist verschwunden. Tina ruft nach ihm, aber er kommt nicht. Der merkt natürlich, die ist am Quatschen, da schau ich lieber mal selbst, wo was los ist.
Der Tod ihres zweiten Kindes stürzte sie in eine schwere Krise. Aber es musste weitergehen, nur wurde das Weiter immer schwerer. Die Trauer begleitete die ganze Familie, wir waren irgendwie gedämpft, sagt Tina. Dann starb der Vater, der Schwiegervater, die Mutter. Da war der Ofen dann langsam aus. Sie machte eine Mutter-Kind-Kur und kam dort das erste Mal mit Kunsttherapie in Berührung. Ich kann aber nicht malen, sagte sie. Egal, sagte die Therapeutin. Sie malte die Familie: die Kinder, den Mann, die Eltern, die Schwiegereltern. Fertig?, fragte die Therapeutin. Fertig, sagte ich. Und wo sind Sie?, fragte die Therapeutin. Da habe ich, erzählt Tina, einfach vergessen, mich selbst mit auf das Bild zu malen.


Das war für mich der Schalter. So möchte ich nicht leben. Ich möchte mich nicht vergessen. Es ist wichtig, dass ich mit dabei bin. Und es war toll zu merken, dass ich mich über das Malen offenbar so tief ausdrücken kann. Dass da eine Wahrheit ans Licht kam, die mir nicht bewusst war. Und dafür muss ich noch nicht mal gut malen können.
Da ist der Alfred ja wieder, haste gut gemacht, sagt Tina, weil Alfred zurückgekommen ist. Wir gehen runter ins Tal.
Sie begann eine Ausbildung als Kunsttherapeutin. Ihr Mann unterstützte sie und sie stürzte sich mit vollem Elan in die neue berufliche Richtung. Im ersten Jahr war es vor allem Selbsterkunden. Und sie lernte, wie man ein echtes Feedback gibt: nicht bewerten, nicht interpretieren. Nur beschreiben. Was sehe ich? Wie ist das Bild gemacht? Das musst du üben, sagt Tina, bis du das verinnerlichst.
Schau mal, ein Reiher. Wir bleiben stehen. Hier ist beim letzten Unwetter ein Junge schwer verletzt worden. Ein Baum ist umgefallen und hat den Jungen beim Radfahren erwischt. Eine große Baumlücke klafft auf der Seite des Weges, und auf der anderen Seite, parallel zur Düssel, sieht man die Leitplanke, die erneuert worden ist. Oft läuft sie hier mit Alfred entlang, bevor sie ins Hospiz geht, wo sie seit 13 Jahren als Kunsttherapeutin arbeitet. Die Sozialarbeit ist quasi im Rucksack mit dabei.




Zusätzlich hat sie noch einen Honorarjob im Krankenhaus, doch da hat sie kürzlich gekündigt. Um Coronapatienten aufnehmen zu können, hatte das Krankenhaus die Palliativstation einfach geschlossen! Zack!, ruft Tina empört. Die Betten wurden für Coronapatienten vorgehalten – aber es lag ja keiner drin. Und dafür wurde monatelang eine Palliativstation geschlossen! Ich finde das so falsch, sagt sie. Und loyal sein zu können, das ist für mich die Grundvoraussetzung, um irgendwo zu arbeiten. Wenn ich in einem System nichts ändern kann, dann will ich wenigstens das System nicht weiter stärken. Bewundernswert, sage ich. Naja, das war schon ein ziemliches Hin und Her, sagt Tina. Und finanziell desaströs.
Und Alfred? Als die Familie sich entschloss, einen Hund zu bekommen, wollte sie wissen, wie so ein Hund funktioniert und hat mit ihm eine Hundetherapieausbildung gemacht. So ein Elo ist wirklich ein fantastischer Hund, sagt sie. Der strahlt dich nicht den ganzen Tag an, aber das würde mir auch ziemlich auf den Geist gehen.
Alfred nimmt sie nicht nur zur Kunsttherapie mit, sondern bietet auch den Hundeführerschein im Kindergarten an. Die Kinder lernen zum Beispiel, wie man sich verhält, wenn man Angst hat. Weglaufen und schreien ist das Gegenteil von dem, was man tun sollte. Ach, denke ich, hätte ich das als Kind auch gelernt!
Alfred ist mit einem anderen Hund beschäftigt und reagiert nicht auf Tinas Rufen. So eine Hundebegegnung ist eben interessanter, sagt Tina. Wenigstens hat er keinen Jagdinstinkt und läuft keinen Wildtieren hinterher.


Die Kinder waren nicht angeschaltet
Das könntest du ja auch ausbauen, das Hundetraining, sage ich. Nö, sagt Tina prompt. Das ist viel zu anstrengend. Auch für Alfred. Wenn dann fünf Kinder den Hund streicheln, sage ich: So, jetzt wechseln wir mal, wer will denn mal der Hund sein? Und der, der besonders doll war, bekommt dann die Rolle vom Hund und dann merkt er schnell, dass er das schon nach 20 Sekunden nicht mehr sein will. Siehste, so geht’s dem Hund auch. Das kommt gut an, aber ist sehr anstrengend. Du hast den Hund, du hast die Kinder – und du hast die Erzieher.
Bei der letzten Prüfung ist es wirklich schlecht gelaufen. Die Kinder waren gar nicht richtig angeschaltet. Manche können noch nicht mal die Leine richtig halten. Keine Körperspannung, das merkt der Hund sofort, dann geht der weg. Dann muss ich denen erst mal beibringen, wie man eine Verbindung herstellt. Wie man eine Beziehung aufbaut.
Denn eine Leine halten, das bedeutet letztlich: den Kontakt halten, zum Hund, aber auch zu sich selbst.
Weiterführende Links zur Straße der Arbeit
Wanderung durchs Neandertal entlang der Düssel
Übersichtskarte (Sauerländischer Gebirgsverein, Bergisches Land)