Sorge
11. Juni 2022

Titel: Die Frage nach der Sorge und Pflege taucht auf, taucht immer wieder auf, in den Ecken und auf den Oberflächen der Dinge und Körper

1. Ziemlich langer Prolog, mit der Überschrift: Sich zu helfen wissen
1.1 |
Am ersten Aprilmontag steht der klingelnde Tür-zu-Tür Eintreiber vom Arbeiter-Samariter-Bund gleich schon vor der Wohnungstür (Alexandra und ich sitzen da noch an den Postern für die Schreibwerkstatt) und sagt mir, dass die Wohnungstüre gerade aufgestanden hätte, ich denke mir, nicht schon wieder. Ich hab die fünf Minuten, nach denen er fragt, und er betont in ihnen mehrmals, dass fünf Euro im Monat eine Entscheidung des Willens seien, keine des Portmonees, es ist also auf jeden Fall irgendwie meine Schuld. Als er realisiert, dass ich, obwohl ich freundlich bin, kein Geld geben werde, kriegt sein Gesicht so einen Ausdruck, nicht unähnlich dem der jungen Männer auf der Bahnhofsstraße, die mich für Tierschutz und Ähnliches anquatschen wollen, wenn ich ihnen, im Weitergehen (nie stehen bleiben) beteuer, heute keine Zeit zu haben, heute nicht, heute wirklich nicht, manchmal mach ich da auch das Victory Zeichen. Was dagegen funktioniert ist, mich, nachdem ich bereits Geld gegeben habe, noch nach zwei, drei weiteren Euros für den vollständigen Döner zu fragen, das haben schon einige Typen erfolgreich gemacht, und wer bin ich denn auch, mich zwischen einen Mann und seinen Döner zu stellen?
1.2 |
Als ich vom Netto kommend auf die Ellerstraße einbieg, merk ich, wie mir Flüssigkeit aus dem Rucksack in die Hose läuft, der Übeltäter ist eine offene Packung Mozzarella, da hock ich schon am Beginn der Eller mit meinen durchnässten Einkäufen über den Boden des Bürgersteigs verteilt und beginn laut zu fluchen, auf diese Scheißstadt, auf alles. Gegenüber auf der Straßenecke das Fan-Projekt Arminia Bielefeld, was glaube ich so was Gemeinnütziges ist oder so.
1.3 |
Dinge, die beim Spülen aus den Händen gleiten, erst übersehene, dann er- schreckende Flecken, eine überraschend niedrige Kellerdecke, das Störgeräusch, das die Boxen machen, wenn man sie angeschaltet am ausgeschalteten Laptop lässt, plötzlich aufgerissene Hände, und vielleicht bin ich auch einfach jemand, um den immer extra viel Staub entsteht. Ich geh zum Supermarkt und vergesse genau die eine Sache, für die ich eigentlich hergekommen war.

1.4 |
Alexandra kennt einen Schneider, und wir beide bringen unsere längst fürs Flicken überfälligen Hosen dort hin, er macht die Arbeit gut.
1.5 |
Zwei ältere Frauen kollidieren fast auf einer Gütersloher Kreuzung mit ihren Rädern, sie haben beide rote Brillen an. Etwas später wird ein älterer Herr auf einer Seitenstraße des porta-Geländes fast von einem herannahenden Geländewagen angefahren. Als ich draußen beim City Grill versuche, meine vegetarische Pita zu essen, ohne dass der ganze Salat auf dem Tisch oder in meinem Schoß landet, – ich hab irgendwie kein Besteck bekommen – sehe ich jemand mit hochgezogener Kapuze auf seinem Rad voll in die Fußgängerzone schießen, und fast erwischt er eine weitere Radfahrerin, genau zwischen den beiden muss ein älterer Herr etwas irritiert guckend inne halten.
1.6 |
Was nicht funktioniert hat bisher, war nochmal Kontakt zu der freundlichen Straßenanwerberin für die neu eröffnete Parfümerie unten im Jahnplatz-Forum zu suchen, ich glaube, sie würde Prozente bekommen, wenn ich bei ihr was hole. Sie drückte mir am Beginn der Bahnhofstraße einen Flyer in die Hand und es war schon zu spät, um wieder umzudrehen, als ich bemerke, dass wir für die angebotene Parfümprobe tatsächlich bis runter unter den Platz in den Laden rennen müssen. Der Shop bietet Parfümzwillinge an, allerdings, wie die Anwerberin betont, haben die Parfüms hier die zweifache Menge an Duftstoff drin. Ich gehe wieder mit der Probe, aber nehme mir irgendwie fest vor, nochmal wiederzukommen, wenn sie da ist, und was zu holen, warum nicht mal zumindest ein bisschen (oder halt doppelt so viel) wie Hermès riechen. Sie war irgendwie nett gewesen, hatte eine Brille an und wirkte sanfter, als ihre Kollegen, sie hatte auch ziemlich lange künstliche Nägel gehabt, mit denen sie die Flakons immer so speziell umgriff. Sonst waren im Laden noch zwei Frauen in Schwarz mit Basecaps und gemachten Lippen gewesen und ein Verkäufer, dessen Haut etwas glänzte.

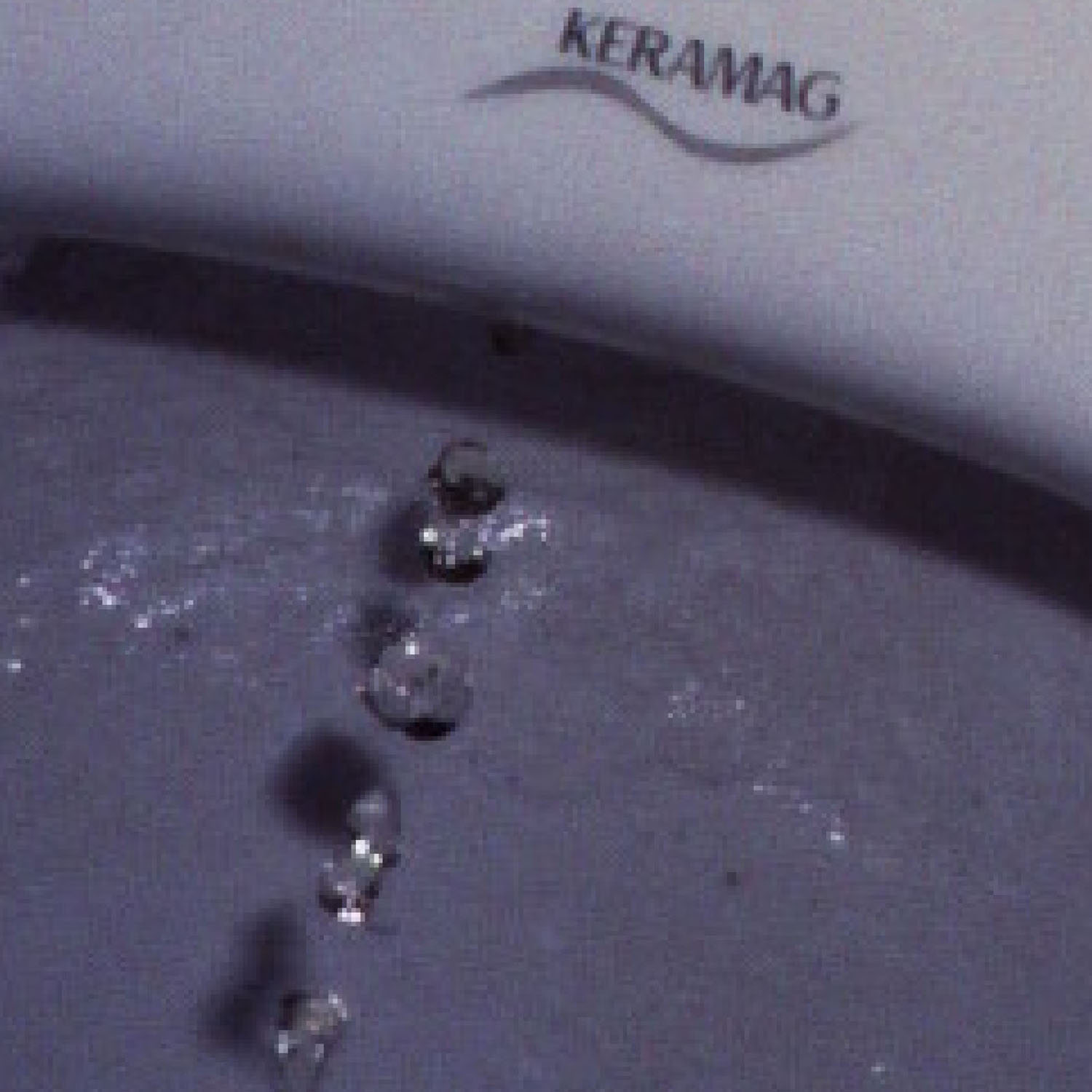

1.7.1 |
Die Tür in der Ellerstraße stand übrigens vor dem ASB Typen schon einmal auf, und zwar gleich die erste Nacht dort. Frau Duisendieker und ihr Freund klingelten am Nachmittag des folgenden Tages, wir trafen uns an der immer noch offenen Tür, sie hatten es am Vorabend schon gesehen, aber da noch nichts sagen wollen. Man müsse diese alten Türen hier im Haus mit Gefühl behandeln, und sie raten mir, einfach den Schlüssel von Innen drauf zu lassen und abzuschließen, und so mach ich es von da an auch. Ansonsten will Frau Duisendieker noch wissen, ob ich geimpft bin und gibt mir Auskunft über den von Martin schonmal angedeuteten Flurdienst, also das Saugen des Teppichs im Treppenhaus. Ich höre sie und ihren Freund ab und an über mir in Ihrer Wohnung herumgehen, Möbel rücken. Ob mich Frau Kemperkötter unter mir wohl auch so hört? Es gibt hier in den Wohnzimmerdielen eine Pfütze des Knarzens, wenn man in die tritt, wird’s kurz immer ganz laut und gefühlt führt jeder Gang durch genau diese Stelle hindurch.
1.7.2 |
Sonst riecht es die ersten ein, zwei Wochen bei Frau Kemperkötter im Haus ganz ähnlich wie früher im Haus meiner Großmutter in Witten, und der Geruch hängt klar auch mit der spürbaren Kühle des Flures zusammen und vielleicht auch mit den Dekorationen vorm Eingang zu Frau Kemperkötters eigener Wohnung im Erdgeschoss. Mit der einsetzenden Wärme des Frühlings verschwindet der Geruch langsam wieder.
1.8 |
Bevor die Blüte des Frühlings allerdings einsetzt fällt mir noch auf, dass echt viel Moos an den Bäumen hier in Bielefeld ist. Es scheint ihnen also gut zu gehen – das hatte ich mal von irgendwo mitgenommen, dass viel Moos ein Zeichen für Baumgesundheit sei, aber ist natürlich und wie üblich keine gesicherte Information.
1.9.1 |
Auch noch vor Frühlingsbeginn, auf der schmalen Straße runter von der Sparrenburg, an der Musikschule vorbei, kommt mir eine Gruppe Männer entgegen, sie sind verstreut hintereinander in ihrem Aufstieg. Ich verstehe sie erst nicht, bis der erste, als ich gerade schon an ihm vorbei bin, sich umdreht und beginnt zum letzten der Gruppe weiter unten zu rufen: „Opa komm. Opa kaputt. Opa hat Nase kaputt!“ In meinen fallenden Schritten muss ich dabei lachen, er sagt das irgendwie keck, und ich lach den gemeinten Nachzügler im Entgegenkommen an, er ist älter und lächelt verlegen, eher sogar verwirrt, und ich verstehe, dass er den Witz seines Bekannten von der Spitze wahrscheinlich gar nicht versteht und so wirkt es, als ob ich oder wir uns über ihn lustig machen. Damn. (Ham wir das nicht aber auch?)
1.9.2 |
Vor diesem Rückweg, noch oben an der Burg, kann ich von einem Festungsvorsprung aus auf die rollenden Grünflächen unterhalb schauen, die Spaziergänger dort, die ein bisschen wie in Computerspielen von Früher aussehen, ¾ von oben, verjüngt. Eine Mutter (vermute ich) entscheidet sich, mit ihren beiden Kindern den Hügel ein Stück gemeinsam herunter zu rollen, die Kids hatten das schon ein paar Mal zuvor für sich gemacht. Die drei rollen los, ein Mann mit Hund taucht parallel von rechts auf, dieser, der Hund, beginnt, sich an den zurückgebliebenen Familiensachen zu schaffen zu machen. Außerhalb des Bildes schließlich ein Schrei: „He! Hundi!“
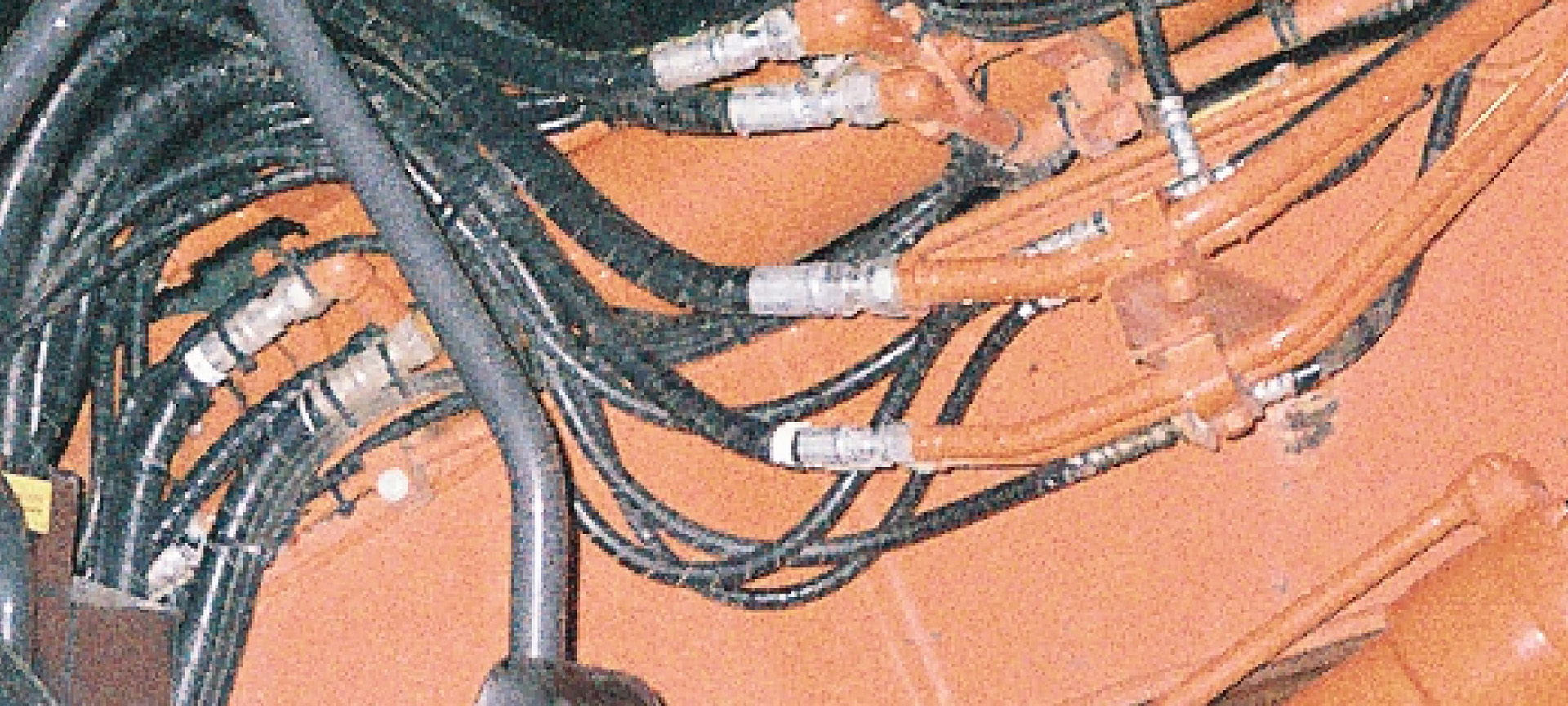



1.10 |
Meine Ausgaben für Kosmetik- und Gesundheitsprodukte sowie Services in diesem Bereich (Fußpflege, Frisör) sind dieses Jahr, bisher noch, vielleicht wider Erwarten, unterm letztjährigen Jahresdurchschnitt geblieben.
1.11 |
Ich hab eine Hämorrhoide vom ganzen Sitzen auf zu harten Holzstühlen hier bekommen (mittlerweile sind genug Kissen am Start). Warum hab ich allerdings und eigentlich keinen, auch in Köln nicht, wirklichen Hausarzt?
1.12 |
Der Staubsauger in der Schmiedestraße funktioniert ganz gut und Thea meint, es sei ein Zeichen einer gesunden Wohnung, wenn sie Spinnen in den Ecken hätte, eine schöne Sichtweise, und übrigens, natürlich sauge ich keine Spinnen ein.

Die Frage nach der Sorge, der Pflege, taucht auf, taucht immer wieder auf, hinter den Objekten und in den Ecken und an den Oberflächen der Dinge und Körper und, unausgesprochen, auf den Mündern der Menschen und Tiere.



2. Der Hauptteil: Etwas von Bethels Geschichte, dazu auch das generelle Thema der Pflege
2.1 |
Ich hole mir den ersten Sonnenbrand des Jahres, als ich, einen Maitag lang, von Wolfgang Bethel gezeigt bekomm, beziehungsweise seine ältere und jüngere Geschichte. Er gibt mir ganz privat eine Führung durch den Ort, der für ihn als Historiker für mehr als ein Vierteljahrhundert seine Arbeitsstätte gewesen ist. Der Wind im nun schon üppig grünen Laub, überall, der Sonnenschein, sie wechseln sich ab mit Gängen durch Verwaltungsgebäude, die Wolfgang immer einfach so betreten kann, kurzes Hallo-Sagen beim Ältesten von Nazareth, hat Anzug, vorher schon beim Bürgermeister von Bethel gewesen, Gregor, er ist Kölner, und wenn man das weiß, dann sieht man das auch gleich. Sein Rad steht neben seinem Schreibtisch und ich tippe, er telefoniert viel an einem Tag. Menschen in Anzügen, Hemden, Blusen, die sich Bruder und Schwester nennen, ab und zu unterbrochen von solchen, die etwas mehr so aussehen, als ob sie Jugendfreizeiten betreuten, und ich habe lange nicht mehr an einem Tag so viele mit ruhiger Stimme sprechende Männer gehört. Draußen im Sonnenschein viele kleine weitere Gruppen, meist jung-wirkende Menschen, ruhig redend, anscheinend die Sonne am Genießen.


2.2 |
Später, beim Verlassen des nahegelegenen Marktkaufs Gadderbaum, mit Sonnenmilch im Jutebeutel (die kann auch nachträglich noch helfen, kleiner Tipp), treff ich denselben Mann, der mich schon einmal vormittags, auf dem Hinweg, vor Edeka am Ostwestfalendamm, angequatscht hatte, er fragt erneut nach Geld, dann erkennt er mich wieder und spricht eines der schönsten Komplimente aus, das ich in meiner Zeit hier bekommen werde: „Du kommst ja auch ganz gut rum.“ Er lebt anscheinend nicht weit von hier, die Rechnung ist ungefähr so: 800 € kostet sein Wohnheimzimmer, dafür sind da aber auch schon ein Sozialarbeiter und Verpflegungssachen mit drin, so ein Mal die Woche, ich glaub, es wird Kaffee als Beispiel genannt. 150 € zwacken die dann noch irgendwie zusätzlich ab, von seinem Hartz IV, und ich geb noch Mal zwei Euro zum Tschüss. Wo wir schon irgendwie bei Geld sind – die größten Einzelspender in der Geschichte von Bethel sind a.) Michiko, die emeritierte japanische Kaiserin, mit sieben Millionen €, die, vor vielen Jahren, bei einem Deutschlandbesuch, über Umwege (genauer: über eine junge, in Bethel arbeitende Ärztin aus Japan) von Bethel erfuhr, spontan vorbeischaute und von dem, was sie sah, wohl beeindruckt war. Ihr zu Ehren der japanische Garten, der eher weiter raus ist, schon richtig im Grünen von Gadderbaum steht. Auch da ganz draußen: die Pferdetherapie und die psychiatrischen Kliniken, Gilead IV, wie Wolfgang bemerkt, vielleicht extra so geplant, weiter weg von den Augen der Stadt. Hier noch ein Einschub über Geographie: Wolfgang bemerkt auch, dass man wohl heutzutage nicht mehr eine Diakonie für Menschen mit Beeinträchtigungen auf einen Berg bauen würde. b.) Der Schlagersänger Heino mit drei Millionen €, auf dessen Anlass die Regel zurückzuführen ist, dass man als Bewohner von Bethel Karten für Konzerte in der Neuen Schmiede immer für 2 € bekommt. Diese Fakten dropt Wolfgang vor der großen Kirche relativ weit oben, wir stehen vor ihrem Haupteingang und können zur anderen Seite durch die Büsche und Bäume den Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach von Gilead I sehen, sieht aus wie ein riesiges Trampolin. Es war dieser Landeplatz, den Judith meinte, als sie davon sprach, dass man von ihrem Ellerstraßen-Balkon aus, die einfliegenden Rettungshubschrauber beobachten könne. Judith ist Wolfgangs Freundin, unser Kontakt kam durch sie. Eigentlich wollen Wolfgang und ich auch noch in die Kirche rein, sie muss, für eine protestantische Kirche, eine Häufung an Engels-Darstellungen aufweisen, die Idee war wohl, Glaubensgrundsätze visuell zu vermitteln, aber sie ist, überraschend, verschlossen. Ein alt wirkendes Paar taucht aus einem Taxi auf, mit sorgsamen Schritten, sie bemühen sich genauso an den verschlossenen Türen, Wolfgang informiert sie darüber, dass wohl zu ist, sie gehen wieder davon, zum Taxi zurück, in einer Stille, die auf etwas verweist, dass sich mir, in seiner Gänze, noch entzieht. Beide haben, in der heutigen Sonne, lange Sachen an und tragen gepolsterte Sandalen mit hellen Socken, ein Style, also zumindest das mit den Sandalen, den auch mein eigener Vater lange gefahren ist, je nachdem auch immer noch fahren würde, wäre da nicht vor elf Jahren ein irreversibler Hirnschaden nach wahrscheinlich Delirium tremens gewesen (aber auch hier: keine ge- sicherten Informationen), jetzt kommt an den Fuß, was meine Mutter gerade griffbereit hat.



2.3 |
Abseits der beschuhten oder unbeschuhten Füße meines Vaters, die sich zumeist in Bochum befinden, machen in Bethel Wolfgang und ich uns von der Kirche aus auf zum letzten und höchsten Punkt unserer Tour, dem alten Friedhof. Ich nutz den Weg, um nochmal nachzufragen, ob er nicht Verbindungen zwischen der Tätigkeit beim Militär und der in einer diakonischen Gemeinschaft sieht, und er sieht sie durchaus, aber ich habe meine Frage nicht präzise genug gestellt, ich wollte ihn eigentlich fragen, ob das für ihn persönlich eine willkommene Parallele war, denn bevor Wolfgang mit Anfang Dreißig noch ein Studium der Philosophie und Geschichte anfing, das ihn als Historiker schließlich nach Nazareth, mit Sarepta einer der diakonischen Gemeinschaften in Bethel, bringen sollte, war er, in seinen Zwanzigern, bei der Bundeswehr gewesen, ich meine (wahrscheinlich beschreib ich das jetzt falsch) bei sowas, wie der Logistik der Fallschirmjäger, er war auf jeden Fall Offiziersanwärter. Am Eingang zum Friedhof angekommen, verweist er mich auf das dahinter gelegene Haus, ein ehemaliges Altenheim, hier hat Judith bis vor Kurzem gearbeitet, bevor sie nun, weiter unten am Berg, einen Neubau bezogen haben. Ich frag, ob es nicht komisch sei, ein Altenheim mit Blick auf einen Friedhof zu bauen und übersehe in der Frage, dass es sich bei den Alten zu einem nicht unermesslichen Anteil um die Diakonissen der Sarepta Schwesternschaft gehandelt hat und auch immer noch handelt, und dass für diese die Nähe zu ihren, auf dem Friedhof beerdigten, den Himmel schon bewohnenden Schwestern etwas sehr Beruhigendes hätte, ein natürlicher Kreislauf sei. Tatsächlich sehe ich die Friedhofswege entlang, mit Wolfgang auf eine Bank, hier auch die ersten und einzigen Diakonissen in Tracht an diesem Tag, es ist die Sommertracht, weiß und grau und von Weitem scheint sie in der Sonne zu leuchten. Wir sitzen da gerade nicht unweit der durchgehend gleich gehaltenen Gräber dieser Diakonissen des alten Weges, die deswegen wohl auch schon häufiger von Besuchern für Soldatengräber gehalten wurden. Noch so ein Friedhofsfakt: In Bethel bekommt jeder eine vollständige Beerdigung, der dort verstirbt. Nun ein Zitat: „Lobet den Herrn mit Posaunen“ (Psalm 150, Vers 3) – das steht auf dem Grabstein von einem der alten Vorsteher von Nazareth, er muss wohl gerne die Posaune geblasen haben, und Wolfgang hat Bilder in Archiven gesehen, wie er besagte Posaune als Darbietung für und vor Adolf Hitler spielt. Einer der älteren Brüder, der sich an den Posaunen- vorsteher noch selber erinnern konnte, meinte einmal zu Wolfgang, nachdem dieser diese Verbindung zu Hitler in einem Vortrag erwähnte, dass besagter Vorsteher ihn als Kind mal bei sich auf dem Schoss habe sitzen und ebenfalls die Posaune vorspielen lassen, und die Erinnerung an diesen Mann würde er sich durch nichts und niemanden mehr nehmen lassen. Auch ein Bethelfakt: In der Zeit des Nationalsozialismus, also vor gut 80+ Jahren, wurden hier über 1600 Menschen zwangssterilisiert. Seit circa 20 Jahren gibt es ein Mahnmal dafür. Über 100 Menschen verloren ihr Leben, weil zugelassen wurde, dass man sie aus Bethel deportierte.


2.4 |
Als ich mich einige Wochen zuvor bei Judith, nach dem Kaffee, schon fast verabschiedet hatte, kamen wir im Flur stehend nochmal aufs Altwerden zu sprechen, wie man es gestalten könnte, möchte: Judith sagt, sie hat keine Angst davor, mal in ein Altenheim zu gehen. Sie arbeitet selber in einem und sieht darin eine gute Alternative, für den Fall, dass man mal Pflege braucht. Ihre Erfahrung aus ihrer Arbeit ist, dass es für die gut läuft, die einen gewissen Kontrollverlust akzeptieren, die sich an den Rhythmus des Altenheims gewöhnen können. Wenn das möglich ist, dann kann es dort schön sein und man entgeht dem Alleinsein im Alter, findet neuen Raum für Gemeinschaft (und, unter der Hand, das sage ich jetzt, den ich hab es so rausgehört: es gibt auch durchaus noch einige Romanzen dort). Aber: alle haben was, denn, unter Pflegestufe 3 kommt niemand mehr ins Heim, wie auch immer diese dann zustande gekommen sein mag, und so hat auch in ihrem Gesprächskreis, den sie einmal die Woche macht und über den wir uns zuvor am Tisch länger unterhalten haben (ich wollte Tipps für die Schreibwerkstatt abholen), jeder etwas: Sehen nicht, hören nicht, erinnern sich nicht. Da muss man gerade bei den Demenz-Patienten manchmal gucken, dass man das auffängt, wenn sie sich anfangen, häufiger zu wiederholen. Ab einem gewissen Zeitpunkt fällt es auch in dieser Gruppenkonstellation auf. Wichtig sei dann, darauf zu achten, eingehend auslenkend zu reagieren, nicht einfach zu verneinen oder zu beschämen. Zwischen meinem Kaffee bei Judith und dem Treffen mit Wolfgang bin ich an einem Sonntag noch in Bochum, bei meinen Eltern und mit meiner Mutter unterwegs, sie kommt gerade zum Auto zurück, sie hat noch schnell ein Brot gekauft (wenn es etwas gibt, das meine Mutter immer noch einmal schnell braucht, dann ist es ein Brot, immer ein Biobrot) und ich frage, ob wir nicht noch ein Stück Kirschkuchen für meinen Vater holen sollten, er hatte, bevor wir auf- brachen, danach gefragt, und sie lacht ein bisschen, fast jeden Tag frage mein Vater nach Kirschkuchen, und jeden Tag könne sie diesen nicht kaufen, alleine schon wegen dem Blutzucker. Aber ihm den Wunsch ausschlagen, warum denn, also sagt sie jedes Mal ja, und manchmal, wenn es sich anbietet, dann macht sie es auch. Vergessen hat er es, bis sie zurück ist, so oder so. Am Küchentisch fällt mir erneut auf, wie wahnsinnig dünn die übereinandergeschlagenen Beine meines Vaters aussehen. Als wir zwischendurch mal nur zu zweit in der Küche sind, fragt er mich ganz unvermittelt, wie ich den heißen würde, erschrickt über meiner Antwort. Das ist glaub ich das erste Mal, das mir das mit ihm passiert ist, manche meiner Brüder kennen das aber schon seit Jahren von ihm. Wenn mir denn was einfällt, versuche ich ihm meistens Fragen über sein Früher zu stellen, da gibt es eigentlich häufiger noch ganz gute Erinnerungsstücke in ihm. Er fragt mich, über den Nachmittag verteilt, immer mal wieder, wie es denn im Studium läuft, und es freut mich, dass er das fragt, er hat selbst mal Kunst studiert.

2.5 |
Der GQ Award für den Tag in Bethel geht, natürlich abseits von Wolfgang und mir, ziemlich klar an Sebastian, einen Pastor, jung und braungebrannt und charismatisch, der auf einem Fahrrad angefahren kommt, in Anzughose und weißem Hemd, aber mit Flip-Flops und baren Füßen. Er kann einen direkt und nett ansehen und hat auch etwas die Unruhe von jemandem, der eigentlich schon weiter muss, gepaart aber halt mit der verantwortungsvollen Ausstrahlung eines Pastors. Wolfgang und er kennen sich, wir sitzen vorm Groß-Bethel Gebäude bei den Fahrradständern und hatten ein paar Minuten zuvor tatsächlich vor Sebastians noch leerem Büro gestanden. Wolfgang wird etwas auf einer Tagung vortragen, die Sebastian organisiert im September, zum Thema Stasi und Diakonie. Und dann ist Sebastian auch schon wieder von dannen, aber manchmal will man ja gerade die kurzen Erscheinungen erwähnen. Später, als wir in der Neuen Schmiede, zum Ausklang, im Garten für ein Getränk sitzen, meine ich, dass mir vielleicht von einem der anderen Tische interessierte Blicke zugeworfen werden, aber auch das bleibt keine gesicherte Information. Habe ich eigentlich schon irgendwas über den Gründer Bodenschwingh erzählt? Und wie alles seinen Anfang nahm, mit vier Diakonissen, und wofür das Sarepta im Namen der Schwesternschaft steht, und wo früher sich in Bethel deren „Garten Eden auf Erden“ befunden hat? Wie sich die Gemeinschaften seit den 70er Jahren reformiert haben? Über die Löcher im Berg und die früher halt noch üblichen Brautkurse? Gerade dieses Ding der Brautkurse? Nein? Fragen Sie doch mal Wolfgang. Der ist im Stillen, natürlich, auch die interessante Figur, an diesem Nachmittag: Er hat eigentlich mal Industriekaufmann gelernt, dann kam der Bund für acht Jahre, das Abi dort nachgemacht, ich meine auch, im Kosovo gewesen. Er kommt aus adeligen Hintergründen, seine Mutter hat jedoch bürgerlich geheiratet. Mit 30 beschließt er, sich nochmal mit etwas zu beschäftigen, dass ihm wirklich am Herzen liegt, und so geht er an die Uni Bielefeld, Philosophie und so studieren, landet, wie schon gesagt, im Archiv in Bethel, bleibt dort über 25 Jahre, fängt an, Aufklärungsarbeit zu leisten, das scheint so auch ein bisschen sein Ding zu sein, bald wird er sein finales Werk zum Thema Diakonie und Nationalsozialismus veröffentlichen, doch die nächste Forschungsroute, in seiner Rente, ist schon benannt und eingeschlagen, nun dann Diakonie und Stasi. Von einem seiner Vorfahren hat er ein eisernes Kreuz vererbt bekommen, ein von den Männern vor ihm verehrter Familienschatz, nun ist er mittlerweile der letzte Mann seiner Linie und von ihm aus kriegt das Ding dann nach ihm gern die Bethelsche Brockensammlung, sagt er lachend, als wir noch oben bei den Gräbern der alten Diakonissen sitzen, später wollen er und Judith Pizza essen.

3. Ein kleinerer Epilog, Überschrift dieses Mal: Hummeln
3.1 |
…vor Kurzem hab ich Judith nochmal auf einen Kaffee getroffen, irgendwie haben wir lange gemacht, ich hoffe nicht zu lange, es war schon kurz nach 11, als ich ging. Sie erzählte mir mehr von ihrer Arbeit und wie der Alltag in ihrem Heim so aussieht, auch, was es eigentlich heißt, heute eine Diakonin zu sein – ah stimmt, Judith ist Diakonin, fyi (das ist allerdings nicht dasselbe wie Diakonissin, egal ob alter oder neuer Weg). Ich erzählte ihr von den Schreib- werkstätten und welche Wehwechen ich so bei der Stipendiumsarbeit hab. Sie erzähle mir auch privatere Dinge, die alles, was sie bis dahin erzählt hatte, in einem anderem Licht erscheinen ließen. Sie hatte wirklich gute Kalamata-Oliven für das spontane Abendbrot am Start, in das das Kaffee-Trinken überging, auch einen fast schon fromm schmeckenden Tee, das ist keine Anspielung auf Judith, nur auf den Tee, der war angeblich das Rezept irgendeiner Heiligen, die schon als Kind an irgendeinem Hof durch ihre Frömmigkeit auffiel, laut Klappentext der Teeverpackung. Es sah sehr edel aus wie die losen Blüten im Teesieb in der Tasse schwammen. Die Tage danach aß ich die übergebliebenen und mitgegebenen Teilchenstücke in der Schmiedestraße, während ich schrieb oder Eurosport schaute.




3.2 |
Ich bin jetzt auch nochmal kurz bei der Zionskirche und dem alten Friedhof ge- wesen, letzte Fakten in Erinnerung rufen, die Grabinschrift von dem Posaunen blasenden Vorsteher zum Beispiel, der hieß übrigens Johannes Kuhlo. Ich hab mir auch nochmal die Namen der beiden Anfang der 1890er Jahre aus Ost-Afrika nach Bethel geholten (es wird erzählt: dort aus der Sklaverei von einem im Urlaub befindlichen Missionar befreiten) und dort dann verstorbenen Kinder aufgeschrieben: Elisabeth Fatuma und Johannis Kali-All. Beide starben in Bethel an der Schwindsucht nach ein paar Jahren. Die ganze Zeit die Hügel von Bethel rauf und runter lag Regen in der Luft. Auf dem alten Friedhof lief ich nochmal die Diakonissengräber ab und bemerkte an einer Stelle, dass die Luft dort schwirrte, fast wie durch Hitze, es waren dutzende Hummeln, die eine blau blühende Strauchgruppe abernteten. Ein jüngerer Mann lief barfuß vorbei. Auf dem Rückweg wurde ich von einem Mann und einer Teenagerin gefragt, wo Haus Ebenezer sei, ich meinte, es gesehen zu haben bei meinem Aufstieg und gab so hoffentlich die richtige Richtung an. Rettungshubschrauber flogen hin und wieder auf Gilead I ein (ah, regionale oder sogar landesweite Schwerpunkte von Gilead sind übrigens: schwere und schwerste Kopftrauma und die Kinderklink). Hoch zum Friedhof war ich an der Zionskirche vorbeigekommen, die dieses Mal auf hatte, so viele Engel konnte ich in ihrem Innern auf die Schnelle nicht ausmachen, aber vielleicht sind für eine protestantische Kirche ein paar ja auch schon eine Menge, mir fiel dafür das Holzdach der Kirche auf, und ich weiß nicht, ob man das darf, aber für einen Moment stellte ich mich hinter das Predigtpult, blickte in die leere Kongregation. Als Kind hatte ich Prediger werden wollen.









