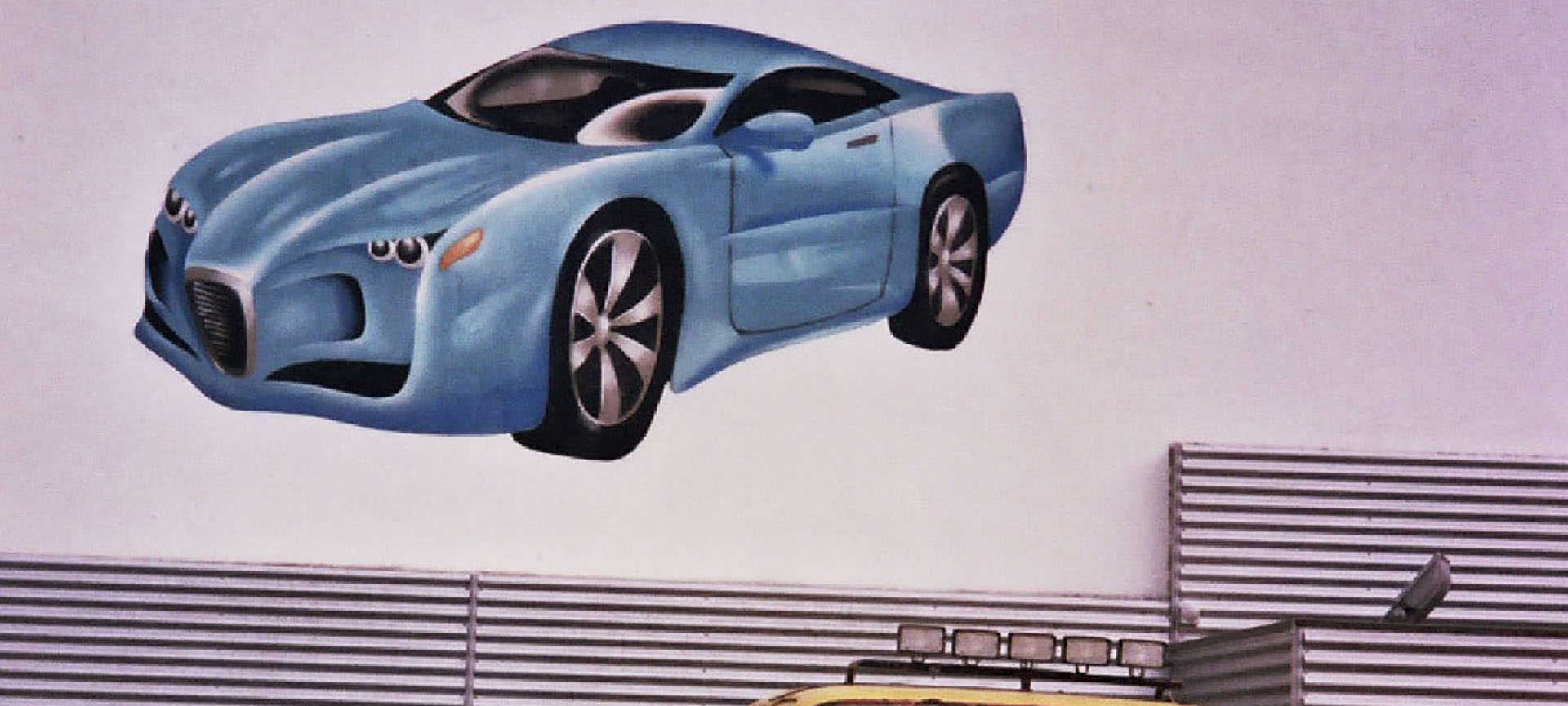Nett
13. Juli 2022

Anmerkung vorab: Das folgende Gedicht "Ich kannte niemanden, und alle waren nett" ist sowas wie mein Abschlusstext für die vier Monate in Ostwestfalen-Lippe. Er fasst die bisher veröffentlichten Gedichte nochmal in einem langen Gedicht zusammen >> allerdings in nochmal teilweise relativ stark korrigierter Fassung und ergänzt um eine Vielzahl weiterer, bisher unveröffentlichter Abschnitte. Der vorliegende Text ist gleichwohl weiterhin nur eine gekürzte Fassung des finalen Gedichts. Heute ist Abgabe für die Anthologie zu stadt.land.text, dies ist mein Versuch, den Text auf eine (hoffentlich) veröffentlichbare Länge herunter zu kürzen. Anyway, überall, wo im Text ein ... auftaucht, wird es irgendwann in einer finalen Fassung noch mehr Text geben, den ich für die nötige Kürze in der Anthologie rausgenommen habe (und für den Post hier nicht wieder reinnehmen wollte, weil mir die Zeit gerade fehlt, diese Abschnitte nochmal Korrektur zu lesen und finaler auszuarbeiten). Cool, das wars erstmal von mir. Ich bin gerade am Literarischen Colloquium in Berlin, noch bis Ende Juli, und muss mich langsam mal darum kümmern, bisschen was über die Hauptstadt zu schreiben. Wish me luck. Cheers, Tobias

Ich kannte niemanden, und alle waren nett



Heepen und die Sonne auf den Stauteichen
Am Ankunftstag, gegen siebzehn Uhr, finde ich mich unter einer kleinen Fußgängerbrücke wieder, sie führt über einen mir noch unbekannten Bach (es wird die Lutter sein), ich stehe mit halb geducktem Kopf da und pinkel in ein Rohr hinein, das wiederum in besagten Bach fließt, der hier zwischen den Hintergärten der Häuser entlang läuft. Eigentlich wollte ich direkt an der Böschung urinieren, aber als ich schon dastand, tauchte weiter vorn am Bachweg ein älterer Herr in einem motorisierten Rollstuhl auf, und ich versteckte mich vor ihm. Er fährt über mich hinweg, als ich gerade Wasser lasse, einen kleinen Hund hat er auch dabei. Danach geh ich wieder Richtung Heepen Zentrum. Dieses Zentrum wird von gut gekleideten Damen bestimmt.
Später ziehe ich über die Flecken der Ausziehcouch die bereitgestellte Bettwäsche. Sie hat auch Flecken, ein Loch. Auf dem Flur schreit jemand, klingt nicht wie ein Hilferuf. Nach ein paar Tagen blute ich, ausversehen, in die Bettwäsche hinein, mal wieder ein aufgerissene Ellenbogen.
Auch am Ankunftstag, unterm freien Himmel, beim ersten Herumlaufen, das Gefühl gehabt, dass alle Lust mir möglich wäre und kurz da auch war.
...




Kraft der Positivität
Was mich dann immer und immer wieder rettet, ist die Musik, und ich habe mich nie genug oder eigentlich auch überhaupt jemals dafür erkenntlich gezeigt, finanziell jetzt, bei den Schaffenden. Jeden Abend auf der Couch in der neuen Wohnung in der Ellerstraße schlaf ich zu ihr ein, viel Piano und Streicher, ist Serien- musik, Bridgerton, Staffel zwei (Kostümdrama-Phase). Auch wichtig ist Kleidung, vielleicht eigentlich ja eher der Körper, den sie bedeckt, aber nach ihm Ausschau zu halten, soweit bin ich meistens noch nicht. Ich mag allerdings die Wärme und die Weichheit meiner neu bestellten Jogginghose, sie ist aus einem fluffigen rosa Stoff, auf dem Bund steht wieder und wieder POWER geschrieben, sie war für Damen bestimmt. Ist mir vielleicht sogar Recht und die größte verfügbare Größe passt gerade so. Ich seh in ihr ein wenig so aus, als hätte ich schon Teile meines Kostüms für Karneval an.
...
Fast drei Wochen vor diesem Besuch steh ich eines frühen Abends im Wohnzimmer in der Ellerstraße und gehe so extra langsam unter der aufgehängten Luftballongirlande vor und zurück, damit mich einer der Ballons immer ganz knapp am Kopf streichelt, da an der Stelle, wo ich schon fast eine Glatze hab. Ich wohn nun bei einer Familie, die selber auch beruflich irgendwo anders ist, anscheinend wurde kurz zuvor noch ein Geburtstag gefeiert. Ich werde die davon zeugende Girlande bis zu meinem Auszug Ende April hängen lassen, es ist fast so, als wäre sie, als Willkommensgruß, für mich bestimmt gewesen.
...
Abends erklingen die Glocken der katholischen Kirche, immer um 18 Uhr, von denen mir Judith schrieb, dass sie die so mag. Sie schrieb mir auch von den Rettungshubschraubern, die man, von Ihrem Balkon aus, mit großer Wahrscheinlichkeit bei einem gemeinsamen Kaffee einfliegen sehen könnte, auf das Dach des benachbarten Franziskus-Hospitals, aber als wir dann tatsächlich bei ihr Kaffee- und-Kuchen machen, kommt keiner und sie entschuldigt sich dafür, was ein bisschen lustig ist. Ungefähr in derselben Nacht steh ich in der Küche am Kühlschrank für Snacks, als ich schließlich einen Hubschrauber einfliegen hör‘, er ist schon weg, bis ich zurück bin auf der Couch. Von dort sehe ich eigentlich immer nur die Weite der schwarzen Nacht, weil das Wohnzimmer seine Fensterseite zum abfallenden Hügel hin hat, auf dem wir alle im Bielefelder Westen stehen, und so scheint es meistens, als schwebe man im All, sieht man von den rot leuchtenden Lampen der Baukräne am Franziskus ab. Wenn ich auf der Couch dann, zur erwähnten Piano- und Streicher-Musik, einschlafe, wach ich meistens eine gute halbe Stunde später wieder auf, mit so einem Gefühl, das mich was an der Kehle hat oder auch, dass da vielleicht etwas an den Fenstern ist. Manchmal putz ich mir dann noch die Zähne, bevor ich im richtigen Bett liege, auf dem Kissen, dessen Geruch ich auch nach einigen Wochen noch nicht identifizieren kann.

Nachtrag: Ich glaube, der Geruch ist sowas wie Kirschkernkissen. Nachtrag: Judith hat den Abschnitt mit den Hubschraubern gelesen und tatsächlich hat sie niemals versprochen gehabt, dass diese aufs Franziskus einfliegen würden, das können sie nämlich gar nicht, da ist kein Landeplatz. Man kann sie allerdings, ab und zu und weiter weg, das Gilead hinter der Sparrenburg ansteuern sehen und hören. Nachtrag: Mittlerweile im Spiegel bemerkt, dass auf der Jogginghose nicht nur POWER sondern POWER OF POSITIVITY steht.



Wie Inseln in der Nacht
Es passiert mir noch etwas, das mir so glaube ich noch nie bis dahin passiert ist, ich schreie einen Mitarbeiter in einer Hotline an. Es ist ein Kaltanruf meiner Sparkasse, Köln-Bonn, mit dem Mitarbeiter habe ich bis dahin noch nie gesprochen gehabt, und ich solle doch langsam mal den neuen AGBs zustimmen, ich sei einer der Allerletzten, die das noch nicht gemacht hätten, und grundsätzlich wünsche sich die Sparkasse von nun an nur noch Kunden, die sie, als Bank, auch zu schätzen wüssten – da vergess ich mich ein wenig. Es hatte aber auch schon nicht so gut angefangen, der Mitarbeiter hatte mich, als ich seinen Anruf entgegennahm, erst für einen Anrufbeantworter gehalten.
Am selben Tag treffe ich abends am riesigen Uni-Hauptgebäude auf einen Vogelschwarm, der sich auf einem Baum an einer Baustelle in einem Innenhof in der eingebrochenen Dunkelheit niedergelassen hat – sie fliegen alle davon, als ich versuche, näher zu kommen. Auf dem Rückweg, den Berg von der Uni wieder hinunter, das vereinzelte Licht der Fenster in den Häusern, die Straßen rauf und runter, wie Inseln in der Nacht.
Neben der rosa Jogginghose bestell ich auch noch ein rotes Kleid, mein erstes, aber als ich die Bestellung bezahlen soll, lass ich mich vom PayPal Interface irreführen und kann meine gespeicherte Kölner Adresse danach nicht mehr ändern, stornieren über die Website geht auch nicht, weil Drittanbieter-Bestellung, laut Mitarbeiterin in der About You-Hotline, aber ich find zum Glück selber noch einen Trick – Tipp: „Annahme verweigern“ in der DHL Sendungsverfolgung markieren - und am Ende war es vielleicht auch alles ganz gut so, wie es gelaufen ist, denn das Kleid wäre in der zuerst bestellten Größe aller Wahrscheinlichkeit nach zu klein ausgefallen, ich bestelle es ein paar Tage später einfach noch einmal, dieses Mal an die richtige Adresse und in größerer Größe, es kommt an und fällt schlussendlich etwas zu groß aus, nur am Hals, an den Armen nicht, und ich behalte es, es hängt rot durch- schimmernd hinter den Hemden aus der Reinigung (nach über einem Jahrzehnt selber waschen und bügeln, gönn ich mir diesen Luxus, den mein älterer Bruder, er ist Berufsmusiker, klugerweise schon seit Jahren macht) an der Tür zum Zimmer, in dem ich penn.
...

Langer Zeitsprung einmal kurz: Es ist Ende Juni, der Tag nach der Abschluss- lesung in Düsseldorf, wir machen ein Familientreffen bei der Familie meines älteren Bruders, meine Mutter ist auch Bochum hergekommen, mein jüngster Bruder aus Trier, mein jüngerer Bruder aus Dresden, wir lassen uns von meiner Schwägerin den Waldkindergarten meiner Nichte zeigen. Mein älterer Bruder ist da schon wieder los zu einem Gig, nach zwei Jahren Corona-Dürre gibt es endlich wieder regelmäßig Aufträge als Musiker. Mein jüngster Bruder bemerkt, dass ich nun, nachdem mein jüngerer Bruder ziemlich eklatant abgenommen hat, der Schwerste unter uns vier Brüdern sei. Wir sind auf einer Wiese im Wald, Spielgeräte stehen auf dieser verstreut herum, auch eine Wippe. Wenn ich mich dort auf der einen Seite auf den hinteren der zwei Sitze setze, kann ich ganz gut meinem jüngeren Bruder und meine Nichte auf der anderen Seite ausbalancieren. Wenn ich den vorderen Platz nehme, klappt es auch mit meinem jüngsten Bruder und meiner Nichte, es sind wohl Hebelgesetze am Werk.
Das rote Kleid war von Ulla Popken gewesen, die ich immer Popeken ausspreche.



Gütig
...
Die New Balance immer noch matschig von diesem Ausflug zum Turm am Tag zuvor, versuche ich sie nun, möglichst ohne Dreck zu hinterlassen, nach der Behandlung, wieder anzuziehen, bei Swetlana, in der medizinischen Fußpflegepraxis Oldentrup. Sie bemerkt mein waghalsiges Spiel allerdings, die bereits verstreuten Krümel, sagt, es sei eh zu spät, und sie müsse den Raum ja sowieso reinigen und ich bin ein bisschen beschämt darüber und beschließe, den Schmutz zu minimieren, indem ich in möglichst langen Schritten wieder vor bis zum Tresen geh und da muss sie lachen, mein Glück, und gewährt mir einen Rabatt. Während der Behandlung hatte ich mitbekommen, wie ein Zehennagel- stück beim Clippen an ihre Stirn geschossen war, und sie hatte mich dafür gescholten, dass ich jedem Hautarzt bisher die Befunde des Vorherigen mitgeteilt habe, so mache man das nicht, die müssten schon selbst erst einmal zu ihren Schlüssen kommen und jetzt leuchtet mir das natürlich alles ein.
Auf der Oldentruper Straße, hin und zurück, hebt der Wind gefühlt fast die Ampeln an, während ich an ihnen warte, und einmal, auf dem Hinweg, im einsetzenden Feierabendverkehr, an der Kreuzung Otto-Brenner-Straße, lässt ein Mann seinen kleinen schwarzen Seat im Wind aufheulen, bis er sich vom Ersten in den Zweiten verschaltet, und die Freiheit der Tage scheint da kurz greifbar, nah.
…
Wieder draußen nach der Batman-Vorführung, geh ich in der mittlerweile angebrochenen Abenddämmerung ein bisschen stadtauswärts und zurück, die Zeit bis zum nächsten Zug zurück von Gütersloh nach Bielefeld vertreibend, in diesem Nach-dem-Kino-Gefühl, das sehr gut ist, wenn man alleine sein darf, und treffe erneut auf die Frau, die früher am Nachmittag noch den Berliner Platz und seine angrenzenden Straßen zugeschrien hatte, und mittlerweile aber, im Vorbeigehen zumindest, ziemlich glücklich, vielleicht sogar glücksselig, wirkt. Am Gleis fallen die Züge erstmal alle aus, eine leise Durchsage folgt: Zugdurchfahrt, und dann kommt auch schon ein ICE mit circa 3.500 Stundenkilometern am Bahnsteig vorbei. Ist vitalisierend.



Die Angst verläuft durch einen
Für zwei, drei Wochen besucht jeden Abend ein ganz bestimmter Singvogel die Gärten nach hinten raus in der Ellerstraße, ich kann ihn selbst durch geschlossene Fenster hören, er taucht jeweils zwischen acht und neun auf, für eine Weile. Es muss einer dieser Vögel sein, die Umweltgeräusche aufnehmen können, denn sein Vortrag klingt jedes Mal vor allem eigentlich nur wie das gesungene Schließsignal von Autotüren. Ich beginne, mich auf seine Gesänge zu freuen. Hier ist jemand, der es versteht, aus seiner Wahrnehmung Gesang zu machen.
Wenn einen die Angst nicht umkreist, verläuft sie durch einen.



Die Frage nach der Sorge tauch auf – Prolog
…
Noch vor Frühlingsbeginn, auf der schmalen Straße runter von der Sparrenburg, an der Musikschule vorbei, kommt mir eine Gruppe Männer entgegen, sie sind verstreut hintereinander. Als ich gerade an ihm vorbei bin, dreht sich der Vorderste der Gruppe um, ruft zum letzten von ihnen weiter unten: „Opa komm. Opa kaputt. Opa hat Nase kaputt!“ Ich muss darüber lachen, er sagt das irgendwie keck, und ich lach den gemeinten Nachzügler im Entgegenkommen an, er ist älter, lächelt verlegen, eher sogar verwirrt, ich verstehe, dass er den Witz seines Bekannten von der Spitze wahrscheinlich gar nicht verstanden hat und so wirkt es, als ob ich oder wir uns über ihn lustig machen. Verdammt. (Ham wir das nicht aber auch?)
Zwei ältere Frauen kollidieren fast auf einer Gütersloher Kreuzung mit ihren Rädern, sie haben beide rote Brillen an. Ich sehe es durch meine eigene rote Brille.
Vier oder fünf Dudes in einem Café im Stieghorst Carré und sie unterhalten sich angeregt und sich gegenseitig bestärkend über ihre Sorgerechts-Probleme, bzw. eher über die damit verbundenen Unterhaltszahlungen. Einem wurde wohl von seiner Schwiegermutter ordentlich Feuer gemacht. Sie sehen cool aus. Auch im Carré steh ich in einer Bäckerei und versuch mich am Lustig-Sein: Während ich hinter der Theke warte, krieg ich mit, wie eine ältere Mitarbeiterin zu einer Jüngeren sagt: „Du kannst mich auch Jasmin nennen“, und als sich diese mir zuwendet, sage ich zu ihr: „Sie können mich auch Jasmin nennen“. Die Mitarbeiterin lächelt etwas irritiert, ich bestell einen Kaffeestreifen. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit ein Tal, darin wartet der Cringe.
...

Die Frage nach der Sorge, der Pflege, taucht auf, taucht immer wieder auf, hinter den Objekten und in den Ecken und an den Oberflächen der Dinge und Körper und, unausgesprochen, auf den Mündern der Menschen und Tiere.




Die Sternzeichen an den Sternzeichenhäusern leuchten bei Nacht
Ich beschließe nochmal rauszugehen, erneut zu den Sternzeichenhäusern zu laufen. Im Dunkeln in der Altstadt auch unter der Woche Leute in Restaurants. Ein Kiosk auf dem Platz da nahe dem Golden Tulip Hotel hat auf, ich hol noch ein Herford Pils, das erste hatte ich gleich schon oben noch auf der Stapenhorst klar gemacht.
...
An den Sternzeichenhäusern selber versuch ich mich ein bisschen an Fotos. Sie leuchten (natürlich) wieder. Eigentlich finden sie alle hässlich, also, das weiß ich jetzt noch nicht, aber in den Wochen danach werde ich mehrmals Leute (Vero, Thea) treffen, die in der Nähe wohnen, und das ist immer ihr Urteil: Hässlich, und man lacht ein bisschen darüber. Ich finde, es ist eigentlich ganz schöne Kunst am Bau. Nach einer Weile weiß ich aber auch nicht mehr, was ich noch machen soll, ich hätte mir besser mal ein paar Horoskope mitgebracht. In meiner Angetüdeltheit setz ich mir wie üblich dann Imbiss-Essen als Fixstern in den Kopf, doch beim Lutter Grill auf dem Rückweg wird schon geputzt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum ich nicht wieder oben auf der Stapenhorst zu City Pizza bin. Vielleicht war ich da schon zu traurig.
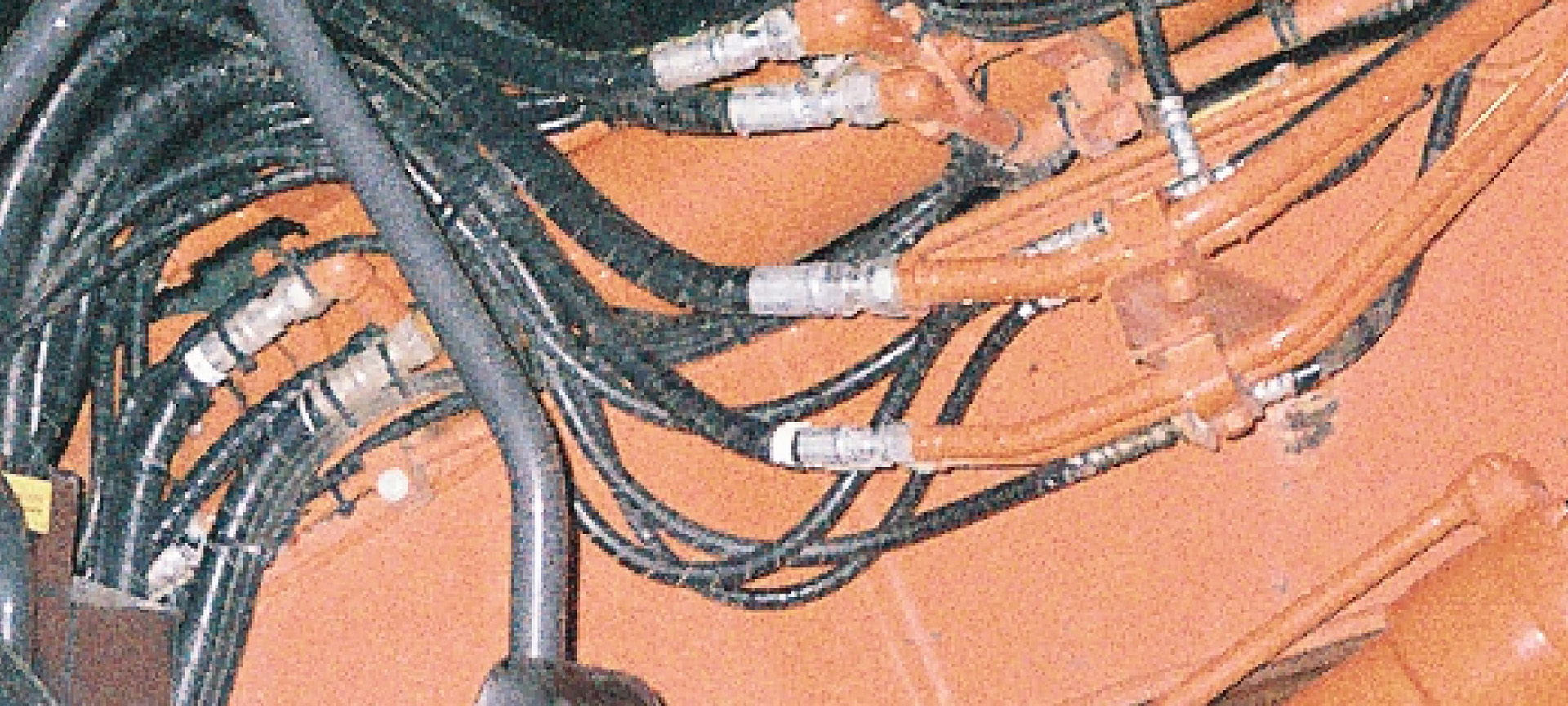

Prophetien I
Auf dem Weg von der Pizzeria zur Bar in Münster sind wir etwas hinter die Gruppe zurückgefallen und beginnen damit, Schneebälle aus den Schneeresten vom Morgen zu formen, dieser, der Schnee, ist aus irgendeinem Grund ausgerechnet und nur auf den Windschutzscheiben der parkenden Autos bis in den Abend liegen geblieben. Ich trage meinen ersten Schneeball eine Zeit lang einfach in der Hand mit mir rum, bevor ich ihn ganz vorsichtig wieder auf einem Poller ableg, Naima sieht es und lacht, es sei sehr German. Ich glaube, fast jeder von uns bei der Stipendiums-Auftaktveranstaltung in Münster hat an diesem Tag berichtet, wie überraschend die Schneedecke am Morgen gewesen war. Für mich hatte es fast was von einem Feiertagsgefühl, morgens noch in Bielefeld aus der Küche runter in den nun weißen Garten von Frau Kemperkötter zu schauen.
Einen Freitag zuvor hatte ich an einem noch sehr sonnigen Nachmittag von der 1. McDonalds-Etage im Bielefelder Hauptbahnhof auf die beginnende Klimademo am Bahnhofsvorplatz geschaut. Wie für Mäcs üblich versuch ich mein Essen auf dem Tablett zwischen meinen eigenen Verpackungsresten zu essen, währenddessen setzt sich der Zug der Demonstranten unten ganz langsam in Bewegung. Es sind über tausend Leute, eher mehr. Es gibt, natürlich, Schilder, Transparente, vor allem aber viele Fahrräder. Alle tragen Maske. Weil ich erhöht sitze, kann ich über den Vorplatz hinaus auch ein Stück von dem dahintergelegenen Park erkennen, in dem mir schon zu Beginn der Woche die Taubenscharen aufgefallen waren. Auch jetzt, aus all der Entfernung, sehe ich die Tauben als kleine grauhelle Punkte fast glänzend im Grün ihr Taubending machen. Sie sind vielleicht die eigentlichen Hüter der Stadt.
...

Ein paar Stunden später, die Stapenhorst wieder runter, auf dem Weg zur Vernissage bei Artists Unlimited, seh ich, an der Ampel beim Franziskus, bergauf, zwischen den ganzen üblichen Autos, einen Lamborghini stehen, sogar ein vom Hersteller nochmal aufgerüstetes Modell, mit mehr Spoilern und einer extra Lufthutze auf dem Dach, sieht eins zu eins aus, wie ein straßenzugelassener Rennwagen, ich meine, das Modell nennt man STO (für Super Trofeo Omo- logato?). Der Dude im Schlitten ist jung, mit einem gestutzten Bart, und ich glaub, er ist am Telefon. Er sieht aus wie jeder Typ, der jemals in so einem Auto saß, heutzutage zumindest. Auf der Vernissage bei AU, erzähl ich von dieser Sichtung und auch von den beiden Ferraris, die kurze Zeit später noch in der Altstadt parkten, und muss gestehen, was ich natürlich ganz lustig und edgy finde, dass so ein Lambo leider geil ist. Ich hab mal über Monaco gelesen, dass dort in den wilden 90ern manche Typen vor dem Casino in ihren Boliden immer mit offener Flügeltür auf und ab fuhren, damit man auch sah, bei wem es gerade lief. Und so entwerfen wir zusammen auf den Bierbänken im Innenhof Szenarios von mir als zukünftigen Dichterfürsten, Grußzeichen durch die offenen Flügeltüren seines Renners in die ihn bewundernden Menge entlassend.
...



In der dritten Wohnung
...
In den Tagen darauf fallen die Blüten des riesigen Kirschbaums als Schnee in das Dickicht des Gartens, Die Brombeeren und Brennnesseln und der wilde Weizen, und was auch immer sonst noch da so wächst, fangen die Flocken auf, ob sie wollen oder nicht.
Nachtrag: Wenn man das riesige Fenster weit kippt, hört man die Tauben und anderen Vögel durchs Blattwerk tappen, die Blätter von allem rauschen und rascheln, dazu die Kinderschreie von hinterm Nachbarszaun und gestern Abend sogar, ein paar Häuser weiter, eine ganze Feier mit Anlagenmusik, bei der wieder nur Kinder bis in die Nacht mitsangen, während sich gleich hinterm Zaun zwei Männer ab und zu etwas zusprachen, in einer Sprache, die ich nicht verstand. Ich hörte Musik.
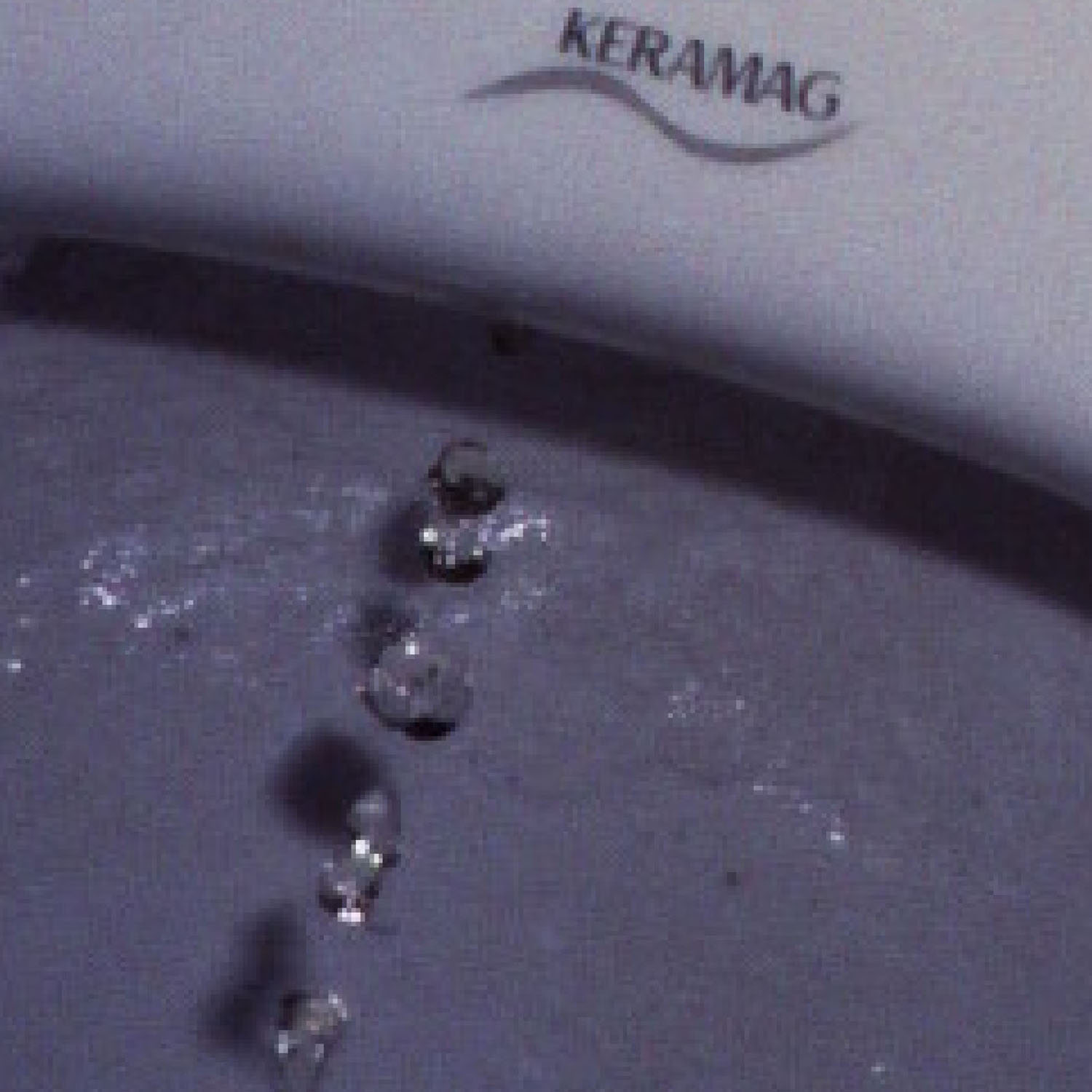



Nur Zeit hast du genug
...
In der Lokalzeit bei WDR empfindet der Moderator mein Hiersein laut seiner Anmoderation als: seltsam und harmlos und nett, und, vor allem aber, und das sollte einen hellhörig machen, wenn es einem selber gilt: als von den Steuergeldern der Zuschauer bezahlt.
Einschub: Ich habe noch nie ein Gedicht darüber geschrieben, wie meine Freunde alle Tiere werden und wir zusammen Baden gehen.
Es gibt keine Kneipenkultur in Bielefeld, sagt Thea, und es wirkt so, als ob sie Recht hätte, wo ich mir versuche, Kneipen in Erinnerung zu rufen, von meinen bisherigen Wegen. In Köln gibt es gefühlt auf fast jeder Ecke eine. Ich frage mich, wo die Leute dann trinken gehen: Auf dem Kesselbrink, klar, und auf dieser einen Bank im Grünstreifen vor Stauteich II. Auch in die Dünen am Hauptbahnhof-Park, da bei der Tüte, zwischen den Tauben. Und vielleicht auch die Treppen hoch die Rückseite vom Hauptbahnhof, zum neuen Bahnhofsviertel hin. Aber das alles, das reicht doch nicht.
...

Einschub: Ich habe noch nie ein Gedicht über Venedig, bei Tag oder bei Nacht, geschrieben.
Ich hab eine Hämorrhoide vom ganzen Sitzen auf zu harten Holzstühlen hier bekommen, und Thea meint, es sei ein Zeichen einer gesunden Wohnung, wenn sie Spinnen in den Ecken hätte.
...
Nachtrag: Ich habe noch nie ein Gedicht über eine Erweckungsgemeinde geschrieben. Ich hab noch nie ein Gedicht über Raumfahrt geschrieben. Ich habe noch nie ein Gedicht über Liebe geschrieben. Ich habe noch nie ein Gedicht geschrieben, in dem ich um Verzeihung bitte.

Wenn ich nur wüsste, wie viel Zeit ich hab.



Die Frage nach der Sorge taucht auf
Ich hole mir den ersten Sonnenbrand des Jahres, als ich, einen Maitag lang, von Wolfgang Bethel gezeigt bekomm, beziehungsweise dessen ältere und jüngere Geschichte. Er gibt mir eine private Führung durch den Ort, der für ihn als Historiker für über ein Vierteljahrhundert Arbeitsstätte gewesen ist. Der Wind im üppig grünen Laub, überall, der Sonnenschein, sie wechseln sich ab mit Gängen durch Verwaltungsgebäude, die Wolfgang immer einfach so betreten kann, kurzes Hallo-Sagen beim Ältesten von Nazareth, hat Anzug an, vorher schon beim Bürgermeister von Bethel gewesen, Gregor, er ist Kölner, und wenn man das weiß, dann sieht man das auch gleich. Sein Rad steht neben seinem Schreibtisch und ich tippe, er telefoniert viel an einem Tag. Menschen in Anzügen, Hemden, Blusen, die sich Bruder und Schwester nennen, ab und zu unterbrochen von solchen, die etwas mehr so aussehen, als ob sie Jugendfreizeiten betreuten, und ich habe lange nicht mehr an einem Tag so viele mit ruhiger Stimme sprechende Männer gehört.
Geographie-Einschub: Gleich zu Anfang fragt mich Wolfang, ob mir irgendwas an der Lage von Bethel auffallen würde, tut es mir nicht (nahe des Zentrums vielleicht als Besonderheit?), er merkt dann an, dass man wohl heutzutage nicht mehr eine Diakonie, die auch für Menschen mit Beeinträchtigungen gedacht ist, auf einen Berg bauen würde. Davon abgesehen ist Bethel die zweitgrößte diakonische Einrichtung der Welt.
...

Abseits der beschuhten oder unbeschuhten Füße meines Vaters, die sich zumeist in Bochum befinden, machen in Bethel Wolfgang und ich uns von der Kirche aus auf zum letzten und höchsten Punkt unserer Tour, dem alten Friedhof. Ich nutz den Weg, um nochmal nachzufragen, ob er nicht Verbindungen zwischen der Tätigkeit beim Militär und der in einer diakonischen Gemeinschaft sieht, und er sieht sie durchaus, aber ich habe meine Frage nicht präzise genug gestellt, ich wollte ihn eigentlich fragen, ob das für ihn persönlich eine willkommene Parallele war, denn bevor Wolfgang mit Anfang Dreißig noch ein Studium der Philosophie und Geschichte anfing, das ihn als Historiker schließlich nach Nazareth, mit Sarepta einer der diakonischen Gemeinschaften in Bethel, bringen sollte, war er, in seinen Zwanzigern, bei der Bundeswehr gewesen, ich meine (wahrscheinlich beschreib ich das jetzt falsch) bei sowas, wie der Logistik der Fallschirmjäger, er war auf jeden Fall Offiziersanwärter. Am Eingang zum Friedhof angekommen, verweist Wolfgang mich auf das dahinter gelegene ehemalige Altenheim, hier hat Judith bis vor Kurzem gearbeitet, bevor sie nun, weiter unten am Berg, einen Neubau bezogen haben. Ich frag, ob es nicht komisch sei, ein Altenheim mit Blick auf einen Friedhof zu bauen und übersehe in der Frage, dass es sich bei den Alten zu einem nicht unerheblichen Anteil ja um die Diakonissen der Sarepta Schwesternschaft gehandelt hat und auch immer noch handelt, und dass für diese die Nähe zu ihren, auf dem Friedhof beerdigten, den Himmel schon bewohnenden Schwestern etwas sehr Beruhigendes hätte. Tatsächlich sehe ich die Friedhofswege entlang die ersten und einzigen Diakonissen in Tracht an diesem Tag, es ist die Sommertracht, weiß und grau und von Weitem scheint sie in der Sonne zu leuchten. Wir sitzen da gerade auf einer Bank, nicht unweit der durchgehend gleich gehaltenen Gräber dieser Diakonissen, die deswegen wohl auch schon häufiger von Besuchern für Soldatengräber gehalten wurden. Noch so ein Friedhofsfakt: In Bethel kann jeder eine vollständige Beerdigung bekommen, der dort verstirbt, unabhängig seiner Finanzen. Nun ein Zitat: „Lobet den Herrn mit Posaunen“ (Psalm 150, Vers 3) – das steht auf dem Grabstein von einem der alten Vorsteher von Nazareth, er muss wohl gerne die Posaune geblasen haben, und Wolfgang hat auch Bilder in Archiven gesehen, wie er besagte Posaune als Darbietung für und vor Adolf Hitler spielt. Auch ein Bethel-Fakt: In der Zeit des Nationalsozialismus, also vor gut 80+ Jahren, wurden hier über 1600 Menschen zwangssterilisiert. Seit circa 20 Jahren gibt es ein Mahnmal dafür. Über 100 Menschen verloren ihr Leben, weil zugelassen wurde, dass man sie aus Bethel deportierte.
Einige Wochen zuvor bei Judith, nach dem Kaffee, kommen wir im Flur stehend nochmal aufs Altwerden zu sprechen: Judith sagt, sie hat keine Angst davor, mal in ein Altenheim zu gehen. Sie arbeitet selber in einem und sieht darin eine gute Alternative, für den Fall, dass man mal Pflege braucht. Btw, und unter der Hand, das sage ich jetzt, den ich hab es so rausgehört: es gibt auch durchaus noch einige Romanzen dort. Aber: alle haben halt was, denn, unter Pflegestufe 3 kommt niemand in ein Heim, und so hat auch in ihrem Gesprächskreis, den sie einmal die Woche macht und über den wir uns zuvor am Tisch länger unterhalten hatten (ich wollte Tipps für meine eigene Schreib- werkstatt abholen), jeder etwas: Sehen nicht, hören nicht, erinnern sich nicht. Gerade bei den Demenz-Patienten muss man da manchmal gucken, dass man das auffängt, wenn sie sich häufiger wiederholen. Wichtig sei dann nur, auszu- lenken, ohne zu verneinen oder zu beschämen. Zwischen meinem Kaffee bei Judith und dem Treffen mit Wolfgang bin ich an einem Sonntag noch in Bochum, bei meinen Eltern und mit meiner Mutter unterwegs, sie kommt gerade zum Auto zurück, sie hat noch schnell ein Brot gekauft (wenn es etwas gibt, das meine Mutter immer noch einmal schnell braucht, dann ist es ein Brot, immer ein Bio-Brot) und ich frage, ob wir nicht noch ein Stück Kirschkuchen für meinen Vater holen sollten, er hatte, bevor wir aufbrachen, danach gefragt, und sie lacht ein bisschen, fast jeden Tag frage mein Vater nach Kirschkuchen, und jeden Tag könne sie diesen nicht kaufen, alleine schon wegen des Blutzuckers. Aber ihm den Wunsch ausschlagen, warum denn, also sagt sie jedes Mal ja, und manchmal, wenn es sich anbietet, dann macht sie es auch. Vergessen hat er es, bis sie zurück ist, so oder so. Am Küchentisch fällt mir erneut auf, wie wahnsinnig dünn die übereinandergeschlagenen Beine meines Vaters aussehen. Als wir zwischendurch mal nur zu zweit in der Küche sind, fragt er mich ganz unvermittelt, wie ich den heißen würde, ich sage es ihm, er erschrickt ganz unverhohlen über meiner Antwort. Zuvor hatte er mich allerdings, über den Nachmittag verteilt, immer mal wieder gefragt, wie es denn im Studium bei mir laufen würde, und das hatte mich gefreut, er hat selbst auch mal Kunst studiert.


Der GQ Award für den Tag in Bethel geht, abseits mal von Wolfgang und mir, ziemlich klar an Sebastian, einen Pastor, jung und braungebrannt und charismatisch, der auf einem Fahrrad angefahren kommt, in Anzughose und weißem Hemd, aber mit Flip-Flops und baren Füßen. Er kann einen direkt und nett ansehen und hat auch etwas die Unruhe von jemandem, der eigentlich schon weiter muss, gepaart aber halt mit der verantwortungsvollen Ausstrahlung eines Pastors. Wolfgang und er kennen sich, wir sitzen vorm Groß-Bethel Gebäude bei den Fahrradständern und hatten ein paar Minuten zuvor tatsächlich vor Sebastians noch leerem Büro gestanden. Wolfgang wird etwas auf einer Tagung vortragen, die Sebastian organisiert im September, zum Thema Stasi und Diakonie. Und dann sind Sebastian und seine sonnenklar sächsische Sprachmelodie auch schon wieder von dannen, aber manchmal will man ja gerade die kurzen Erscheinungen erwähnen.
...
Zum Abschluss ist es vielleicht wichtig zu erwähnen, dass, im Stillen, natürlich, eigentlich auch Wolfgang die interessante Person ist, an diesem Nachmittag: Er hat Industriekaufmann gemacht, dann der Bund für acht Jahre, Abi dort nachgeholt, ich meine, auch im Kosovo gewesen. Er kommt aus ehemals adeligen Hinter- gründen. Mit 30 beschließt er, sich endlich mit etwas zu beschäftigen, dass ihm wirklich am Herzen liegt, und so geht er an die Uni Bielefeld und landet, und das nur dank der Hilfe vieler Mentoren, wie er betont, schließlich im Archiv in Bethel, wo er über 25 Jahre bleibt, anfängt, Aufklärungsarbeit zu leisten, das scheint auch so ein bisschen sein Ding zu sein, bald wird sein finales Werk zum Thema Diakonie und Nationalsozialismus erscheinen, doch die nächste Forschungsroute, für die Rente, ist schon eingeschlagen, nun dann Diakonie und Staatssicherheitsdienst. Von seinen Vorfahren hat er ein eisernes Kreuz vererbt bekommen, ein von den Männern vor ihm verehrter Familienschatz, nun ist er der letzte seiner Linie und von ihm aus kriegt das Ding dann nach ihm gerne die Brockensammlung in Bethel, sagt er lachend, als wir noch oben bei den Gräbern der alten Diakonissen sitzen, später wollen er und Judith Pizza essen.


Die Frage nach der Sorge taucht auf – Epilog
…vor Kurzem hab ich Judith nochmal auf einen Kaffee getroffen, irgendwie haben wir lange gemacht, ich hoffe nicht zu lange, es war schon kurz nach 11, als ich ging. Sie erzählte mir mehr von ihrer Arbeit und wie der Alltag in ihrem Heim so aussieht, auch, was es eigentlich heißt, heute eine Diakonin zu sein – ah stimmt, Judith ist Diakonin, fyi (das ist allerdings nicht dasselbe wie Diakonissin). Ich heulte ihr ein bisschen was von meinen Stipendiums-Wehwechen vor . Sie erzählte mir auch privatere, gesundheitliche Dinge, die alles, was sie bis dahin erzählt hatte, in einem anderen Licht erscheinen ließen. Sie hatte wirklich Gute Kalamata-Oliven für das spontane Abendbrot am Start, in das das Kaffee-Trinken überging, auch einen fast schon fromm schmeckenden Tee, das ist keine Anspielung auf Judith, nur auf den Tee, der war angeblich das Rezept irgendeiner Heiligen, die schon als Kind an irgendeinem Hof durch ihre Frömmigkeit auffiel, laut Klappentext der Teeverpackung. Es sah sehr edel aus wie die losen Blüten im Teesieb in der Tasse schwammen. Die Tage danach aß ich die übergebliebenen und mitgegebenen Teilchenstücke in der Schmiedestraße, während ich schrieb oder Eurosport schaute.
Ich bin jetzt auch nochmal kurz bei der Zionskirche und dem alten Friedhof ge- wesen, letzte Fakten in Erinnerung rufen, die Grabinschrift von dem Posaunen blasenden Vorsteher zum Beispiel. Ich hab mir auch nochmal die Namen der beiden Anfang der 1890er Jahre aus Ost-Afrika nach Bethel geholten (eher wohl verschleppten? Es wird erzählt: dort aus der Sklaverei von einem im Urlaub befindlichen Missionar befreit) und dort dann verstorbenen Kinder aufgeschrieben: Elisabeth Fatuma und Johannis Kali-All. Beide starben an der Schwindsucht nach ein paar Jahren. Die ganze Zeit die Hügel rauf und runter lag Regen in der Luft. Auf dem alten Friedhof lief ich nochmal die Diakonissengräber ab und bemerkte an einer Stelle, dass die Luft dort schwirrte, fast wie durch Hitze, es waren dutzende Hummeln, die mehrere Sträucher mit blauen Blüten bestäubten. Ein jüngerer Mann lief barfuß vorbei. Auf dem Rückweg wurde ich von einem Mann und einer Teenagerin gefragt, wo Haus Ebenezer sei, ich meinte, es gesehen zu haben, bei meinem Aufstieg, und gab so hoffentlich die richtige Richtung an. Rettungshubschrauber flogen hin und wieder auf Gilead I ein (ah, regionale oder sogar landesweite Schwerpunkte von Gilead sind übrigens: schwere und schwerste Kopftrauma und die Kinderklink). Hoch zum Friedhof war ich an der Zionskirche vorbeigekommen, die dieses Mal auf hatte, viele Engel konnte ich in ihrem Innern auf die Schnelle nicht ausmachen, mir fiel dafür das Holzdach der Kirche auf, und ich weiß nicht, ob man das darf, aber für einen Moment stellte ich mich hinter das Predigtpult, blickte in die leere Kongregation. Als Kind hatte ich Prediger werden wollen.


Rund um Hedem
Auf dem Rückweg vom Nordpunkt – dem, wer würde es denken, nördlichsten Punkt NRWs – zur RB-Endhalte in Rahden kommen Rahel und ich doch noch und zum ersten Mal ernsthaft an diesem Tag auf das Thema der Landwirtschaft zu sprechen, wir hatten es, mit Ausnahme von Rahels Einwürfen hier und da beim Rumfahren, wo gerade noch ein Feld von ihrem Mann oder anderen Bekannten bestellt wird, auf unserer Tagestour durch den hohen Norden bisher gar nicht groß damit gehabt. Das war Rahel wohl auch Recht so gewesen, wie sie nun sagt, es sei kein leichtes Thema, wenn man selber mittendrin sei. Und warum treffen Leute in Berlin Entscheidungen für die Landwirtschaft, die selber mit dem Thema überhaupt keine Berührungspunkte zu haben scheinen? Als wir noch am Nordpunkt stehen und diese Marmorskulptur betrachten, die den Umriss von NRW zeigt, mit einigen eingravierten Städten auf ihrer Oberfläche, fällt mir auf, dass Dortmund ja tatsächlich mehr oder weniger die Mitte unseres Bundeslandes ist. Wahrscheinlich, weil ich halt lange in meiner Rheinland-Bubble gewesen bin, hatte ich als Zentrum, natürlich, immer Köln gesehen.
...


Das erste gute Essen gabs, vor den Horns, gleich bei Rahel und ihrer Familie selber, auf dem Hof, den ihr Mann Georg von seinen Eltern übernommen hat, zur Mittagessenszeit: Rahels Mutter hat extra Schweinebraten gemacht, dazu gibt’s natürlich Bratensoße, auch grüne Erbsen, vor allem aber komplett, und ich meine komplett selbstgemachte Klöße, auch Kartoffelstücke, die ich aber wegen der Klöße schmähe (sorry), und zusätzlich, vielleicht mein stiller Star, einen Salat, der aus Salatgurken, grünen Bohnen, Zwiebeln besteht, ich meine, in einer Tupperdose serviert, und der auf eine schöne Art süß ist. Die Nachspeise dann betont westfälisch: Quark mit Kirschen und Schokosplittern und zerkrümeltem Schwarzbrot. Großeltern, die Essen machen: War immer eine Sache, wird wohl immer eine bleiben, zum Glück, und mal so sehr generell gesprochen. Interessanter- weise mag Rahels Tochter die Nachspeise nicht so gern, sie ist ihr zu durcheinander, was die Zutaten angeht, und das deckt sich voll mit den Beobachtungen über das Elternsein, die ich selber bei meiner Nichte derzeit machen kann, auch dort wird eigentlich alles immer nur ohne alles gegessen. Ich weiß nicht mehr, ob meine Brüder und ich auch so waren, meine Mutter erzählt schon manchmal im Nachhinein Geschichten gewisser Partikularität, aber, ernsthaft jetzt mal, nachdem meine Eltern McDonalds als Lösung gefunden hatten, ging das schon wirklich immer, also jetzt Sonntags oder mal so zur Belohnung, aber ich drifte ab, wie so häufig, wenn das goldene M ins Spiel kommt.
Jeder übrigens, den wir an dem Tag treffen, hat einen oder mehrere Hunde, und Rahels Familie ist da keine Ausnahme, sie haben zwei. Der jüngere, Simba, ist ein wilder Golden Retriever, der sich aber mehr und mehr beruhigt, seit er in der Jagdhundausbildung bei der Schwester von Arnold von der Nolden ist, den wir gleich als Erstes, nach meiner Ankunft am S-Bahnhof Bald Holz- hausen, am Vormittag noch, besuchten, und der mir oder uns, ganz grob natürlich nur in der Kürze der Zeit, circa acht Jahrhunderte Geschichte über Burg Steinsegen erzählt, das Anwesen seiner Familie, das er, seit den Siebzigern, mit seiner Frau, verwaltet. Irgendwann merkt Herr von der Nolden, dass ich wirklich fast niemanden der historischen Figuren, die er referenziert, einordnen kann, klar, von allen mal den Namen gehört, mehr aber auch nicht, aber wenn ihn das tiefergehender enttäuscht, lässt er es sich, dankenswerterweise, nicht anmerken, alles Wasser unter der Brücke für ihn, wahrscheinlich. Als wir auf der Brücke über dem letzten noch erhaltenen Burggraben sind, macht uns von der Nolden auf ein spitzes Dach im Unterholz aufmerksam. Das war früher der Eiskeller – im Winter, als das Wasser im Graben gefror, hob man von ihm die Eisplatten ab und lagerte sie dort ein, in einem fünf Meter tief gegrabenem Loch, unter besagtem Spitzdach. Das Eis hielt sich für den ganzen Rest des Jahres, in der Kühle der Erde, zur Nutzung in der Küche, für den Betrieb der ersten Vorläufer der heutigen Kühlschränke.
...

Mein liebstes Detail, das von der Nolden auf seine ruhige Art und fast schon schelmisch einmal kurz erwähnt, ist in der Eingangshalle zu Schloss Steinsegen zu finden, eine erst unscheinbar wirkende Eimerform unter einer der wieder aufgebauten Original-Holzstreben. Es handelt sich tatsächlich um einen mit Zement ausgegossenen Eimer, lackiert wie das Holz, genutzt, um die fehlende Länger der an dieser Stelle zu kurz gewordenen Strebe auszu- gleichen. Diese Notfalllösung war einem der Handwerker aus Polen gekommen, die von der Nolden häufiger in seinen Erzählungen der Grund- renovierung des Schlosses seit den 70ern erwähnt, und ohne die er, wie er selber sagt, dieses zu Anfang völlig aussichtslos wirkende Unterfangen niemals hätte bewältigen können. Eigentlich geht es die meiste Zeit darum, halt mit dem zu arbeiten, was man so hat. Die Malerarbeiten am Fachwerk im Innenhof hätten, wenn Denkmal-gerecht in Auftrag gegeben, so zum Beispiel weit über 30 Tausend Euro gekostet, von der Nolden entschied daraufhin, es einfach selber zu machen, und bekam dabei Unterstützung alter Freunde aus seinem Chorverein, er wirkt stolz auf das Ergebnis, als er es uns zeigt und kurz irritiert, als ich erst nicht raffe, was ein Chorverein ist, tatsächlich ist das glaub ich eine Art von Studentenverbindung.
Und die Geschichte der Leute auf Steinsegen, ihrer wechselnden Besitzerfamilien? Nun ja, gibt es viel halt, sowas sammelt sich ja über acht Jahrhunderte, aber vielleicht bleibt am besten festzuhalten, dass die Burg seit dem 18. Jahrhundert nun schon im Besitz der von der Noldens ist, auch, wenn es manchmal sehr knapp gewesen sein mag, der ein oder andere Onkel das Anwesen fast in den Ruin getrunken hätte, zum Beispiel. Es gab auch mal einen von der Nolden, - das war aber glaub ich noch vor ihrer Zeit auf Steinsegen - der, um seine Stärke zu beweisen (und zu beweisen, dass er stärker war, als der Fürst, der ihn als Gast bei sich hatte), mal gegen einen Bären kämpfte, während einer Abendveranstaltung, zur Erheiterung der Gäste, und gewann.
...

Gegen Mitte unseres Trips fällt mir noch Folgendes auf: Ich habe einen einzigen Gegenstand in meinem Besitz, den ich nicht mit meiner eigenen Körperkraft davontragen könnte, das ist mein ziemlich oller Schreibtisch, aus einer vergangenen WG übernommen. Mit Rahel in ihrem schwarzen Tiguan fahren wir durchs Land, und überall ist eine gewisse Weite, Gewicht. Felder, der Hof, die Landmaschinen, ganz selbstverständlich gibt es hier Dinge, die einem gehören und das Zehn-, das Hundertfache eines menschlichen Körpers wiegen, sich schon gar nicht mehr gegen ihn aufwiegen lassen, im Falle der Felder ja auch was-weiß-ich-wie-viele Körper ernähren. Rahel sagt, dass mit all diesem Besitz auch ein Gefühl der Verantwortung komme, diesen sinnvoll zu gebrauchen. Es gibt dieses Gefühl auf dem Land, dass man sich selber und miteinander die Dinge schaffen muss, die man braucht, auch, weil es sonst keiner für einen macht. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben so viel an einem Tag über Häuser und Hausbau geredet habe, aber auch das scheint hier eher Notwendigkeit zu sein, genauso, wie das Autofahren. Apropos, es ist nice, dass Rahel eine der Kunden ist, die ihren SUV tatsächlich für das Fahren im Unterholz benutzt, sie zeigt mir gleich zu Beginn ein paar Waldpfade rund um Steinsegen. Rahel ist übrigens aufs Land zurückgekommen, und sie hätte es meines Erachtens sicher auch weiter in einer Großstadt ausgehalten, so wirkt sie zumindest auf mich. Sie selber betont allerdings lachend, dass es für sie schon das volle Leben sei, nun mit dem Hof von Georg mitten im Ort auf der Hauptstraße zu wohnen und nicht mehr am Rand, wie in ihrer Kindheit in Rahden, da waren wirklich nur Felder um sie herum. Georg hat von Anfang an Ja zu Hedem gesagt, auch zur Landwirtschaft, in seinem Fall und im Vergleich noch zu z.B. Rahels Eltern betreibt er diese sogar im Haupterwerb, er hat sie auch studiert, und für ihn ist das Bestellen der Böden eine Passion und eine Wissenschaft, sagt Rahel, und Rahels Vater staune zumeist nicht schlecht, was Georg mit seinem Wissen alles noch aus den Böden herausholen könne.
...

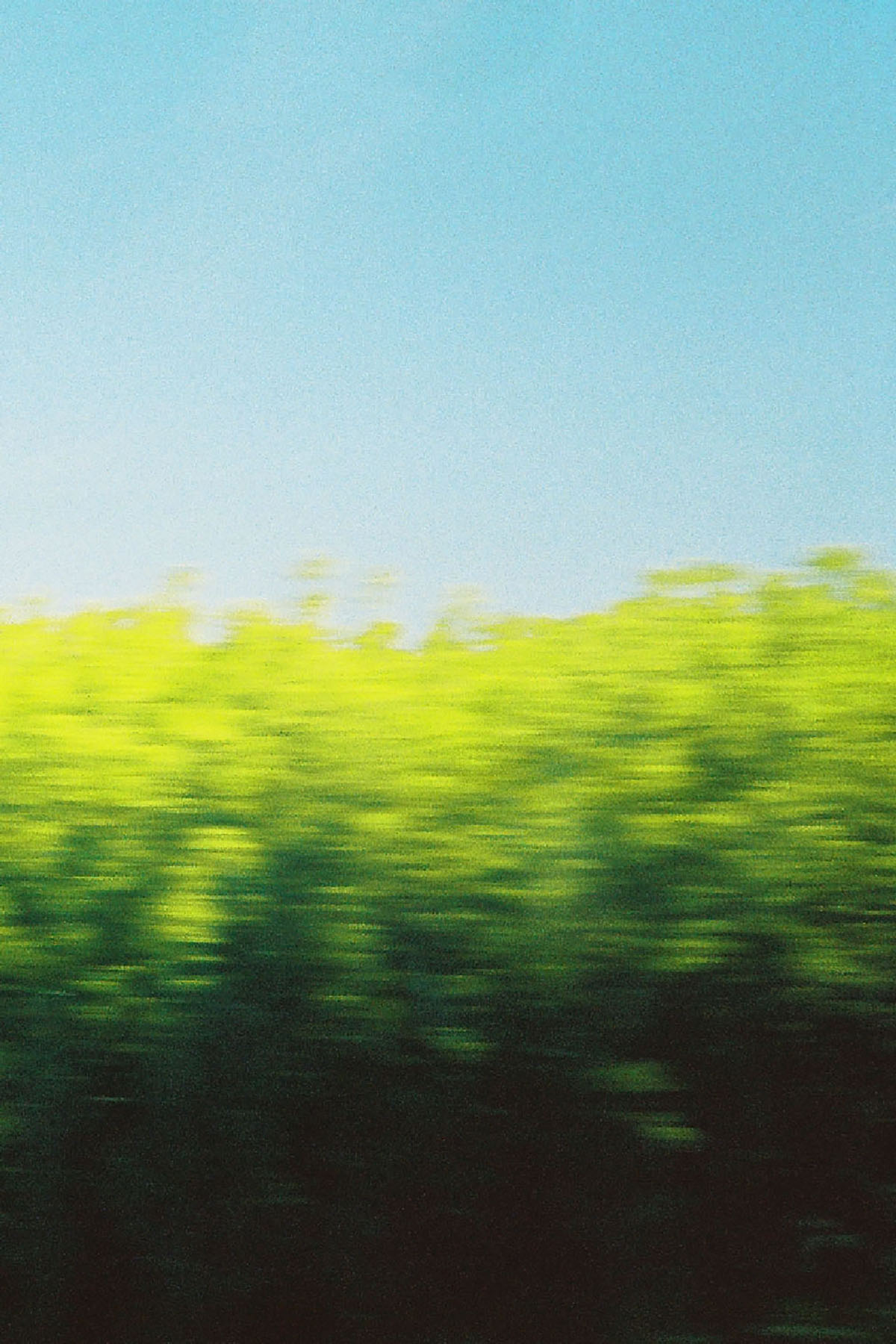
Im Zentrum von Rahden kommen wir an der einen super beliebten Eisdiele vorbei, Rahel erzählt ein wenig schmunzelnd, dass es mal irgendwelche Stadt- planungen gegeben hätte, die entweder, wenn ich mich recht entsinne, gleich die ganze Eisdiele oder zumindest einen Brunnen oder Bänke, auf denen alle ihr Eis anschließend immer essen, platt machen wollten, und das wäre ein riesiges Thema im Ort gewesen, in der Zeitung diskutiert, schlussendlich dann auch gekippt worden. Wir fahren an den weiter Eis-essenden Menschen von Rahden vorbei. Manchmal wissen sich die Leute schon noch zu helfen.


Prophetien II
Irgendwie kommt dann doch noch dieser Beitrag für die WDR Lokalzeit ins Rollen. Einen Freitag vor meinem Live-Auftritt treff ich mich mit Celine, einer freien Journalistin, damit wir vorab einen Einspieler drehen können, er soll 1 ½ Minuten und irgendwie pfiffig und lokalbezogen sein und der größte Spaß dabei für mich ist, in den vollen Fußgängerzonen der Bielefelder Altstadt leise zu uns anschauenden Leuten „Hilfe“ zu sagen, während mir Celine mit etwas Abstand hinterherläuft und von hinten filmt. Unterhalb der Promenade, an den Hundewiesen, finden wir auf einer Parkbank den letzten Drehort, damit ich noch ein paar möglichst kurze und lustige Abschnitte aus den bisher geschriebenen Texten einlese. Celine wird von einem vorbeikommenden Hund angesprungen, ich solle mit mehr Enthusiasmus lesen, über mein ständiges „okay“ muss sie allerdings lachen, es erinnere sie an Forrest Gump. Nicht unweit dieser Bank habe ich einige Wochen zuvor mal abends, als es schon dunkel war, mit Vero gesessen, sie hatte mir vorher den Unterschied zwischen Bärlauch, Maiglöckchen und einem dritten Kraut erklärt, als wir noch bei ihr im Gemeinschaftsgarten saßen, Vero hat dieselbe Lieblingskneipe wie Alexandra, in die mich beide während der Zeit in Bielefeld mehrmals einladen, und an dem Abend mit Vero lauf ich irgendwann sekttrunken die Promenade zurück nach Hause, sehe die angestrahlte Sparrenburg, bis auf ein paar Leute auf einer Parkbank kurz zuvor ist keine Menschenseele zu sehen, ich denk mir, irgendwie profund: Die Sparrenburg ist einfach da.
...



Wem gehört die Zeit?
Wenke und ich halten mitten auf der Straße, um noch eine Windkraftanlage zu fotografieren, aus dem Auto heraus, ein paar Locals (genauer: eine ältere Dame in einem Ford und ein schon richtig alter Herr auf einem Rad) müssen um uns herum und fucken sich darüber ab, verständlicherweise, wenn ich ehrlich bin.
...
Wir sind auf dem Weg weg von der Wewelsburg und irgendwo hin, wo wir was Essen können, wahrscheinlich geht das in Büren. Wenke und die Direktorin der Burg hatten vorher beide sehr farbenfrohe Klamotten getragen, Wenke trägt sie auch immer noch, ich hab, aus irgendeinem unerfindlichen Grund, ausgerechnet an diesem Tag eher ein dezentes Hemd an. Auffällig viele Mitarbeiterinnen der Wewelsburg schienen farbenfrohe Kleidung zu haben.
...
Nach unseren Bifteki schaffen wir es in der Abendsonne tatsächlich noch raus zu den Externsteinen, wir parken am Straßenrand, vor dem offiziellen und bezahl- pflichtigen Parkplatzgelände, Wenke will sich die Gebühren sparen, ich habe Sorge, dass wir vielleicht abgeschleppt werden, gleich unten gegenüber der Parkplatzeinfahrt gibt es einen größeren Teich und auf seiner Oberfläche sind nun im glänzenden Abendlicht Mücken ohne Ende, ein Konzert, oder eine Gala, oder so, ein junger Mann mit Bart und einem ziemlich langen Objektiv schießt Fotos, aber eher wohl vom sich anbahnenden Sonnenuntergang. Auch beim zweiten Besuch wirkt alles, das Areal und die Steine selber, ein bisschen wie Phantasialand.
...


Ich bin auch nicht aufs Hermannsdenkmal raufgelaufen, das war noch etwas vor Horn Bad Meinberg gewesen, am Tag der Arbeit (1. Mai). Während ich da vor dem Denkmal stehe und warte, ob ich nicht vielleicht doch noch etwas Mut finde, koordiniert auf der Treppe hoch zum Eingang ein Vater sehr geschickt einen ganzen Ausflug an Kindern für den gemeinsamen Aufstieg, es hängen auch noch mehrere Erwachsenengenerationen an der Gruppe mit dran. Ich mache zumindest dahingehend das Touri-Ding allerdings, als dass ich mir später ohne großes Wimpernzucken für fünf Euro eine Halbliter-Flasche Cola hole. Während ich weiter warte, kommt ein Paar auf ganz ansehnlich ausladenden Mountainbikes den Weg hinauf, kreist einmal ums Denkmal drum herum, er fährt ohne zu Halten gleich wieder den Weg bergab, „Was soll man schon hier?!“, ruft er über die Schulter hinweg seiner Begleitung zu, sie schaut etwas verwirrt hinten drein, vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, sie hat ein Jersey an, das wie von NASCAR oder vom Motocross aussieht. Auf den breiten Treppen runter zu dem Aussichtspunkt gleich hinterm Denkmal erzählt eine Mutter ihrer Mutter und ihren Kindern etwas von den früheren schrecklichen Zeiten, und irgendwie wird mir da fast ein bisschen schlecht, vielleicht bin ich aber auch nur traurig, dass gerade einige Schulklassen die gesamte Mauer des Aussichtspunktes beanspruchen. Am Denkmal und dieser einen abgebrannten Hütte wieder vorbei und runter zum Hauptareal für Snacks und Souvenirs, gönn ich mir noch eine Pommes, dann steig ich wieder hinab, nach Detmold zurück, wieder zu Fuß, aber dieses Mal find ich einen Waldweg für den Abstieg – hoch war ich den dankbar einfachen Routen- angaben eines Kioskbesitzers aus dem Detmolder Hauptbahnhof gefolgt, dieser vorgeschlagene Weg war aber halt nur Straße gewesen, und auf der hörte nach dem Ende der Siedlungen auch der Gehweg auf, also ging ich die folgenden Serpentinen durch den Wald, wie früher mit meinen Eltern auf irgendwelchen Wanderungen, am Fahrbahnrand, ab und zu schlichen Rennradfahrer gehobenen Alters auf der letzten Rille vorbei, später sehe ich welche von ihnen bei der Fünf- Euro-Cola wieder, einer macht da so ganz komisch und vielleicht als Kritik daran gemeint das lautstärkere Weinen eines nahegelegenen Kindes nach. Beim Aufstieg der Raps im Tal weiter unten blühte voll und mir war zu heiß unter meiner Jacke.
...

Als Alexandra (die Alexandra aus der Nähe von Horn-Bad Meinberg, nicht die aus Bielefeld) und ich einige Wochen später an den Externsteinen sind, spielt uns gleich ein oberkörperfreier Typ auf der Flöte auf, an dieser Durchgangsstelle, wo sich die Bäume des Waldes hin zur Wiese vor den Steinen lichten. Während wir ihn passieren, hält er inne, spricht: „Willkommen an den Externsteinen.“ Kurz davor, noch im Wald, auf dem Weg von den Parkplätzen her, war ein verballerter Dude gewesen, der, wie es schien, bereits für diesen Nachmittag in Alkohol gemacht hatte. Am Jesusgrab weist mich Alexandra auf die dort eingeritzten Runen hin. Wir laufen eine ganze Zeit lang durch das Waldgebiet hinter den Steinen, Alexandra erzählt mir von einer Filmidee, eine Sciene-Ficiton-Geschichte, basierend auf einem Traum, es ging in ihm um alternative Logistiklösungen, ohne zu viel vorab zu verraten. Irgendwann führt uns der Weg ein wenig ins Unterholz und wir kommen auf einmal auf der rückseitigen Straße eines Wohngebiets heraus, Alexandra weiß allerdings gleich, wo wir sind und wie es zurück geht. Während wir da so wieder aus dem Wald in die Zivilisation hervortreten, schaut uns ein Mann aus seiner offenen Garage heraus an, schaut uns weiter an, solange, bis wir die Straße herunter aus seinem Blickfeld heraus sind. Zurück an den Steinen ist da wieder der besoffene Typ, er hat mittlerweile den Schatten des Waldes verlassen, sitz oberkörperfrei in der Sonne.
...



Auch an Laden und Schaufenster erinnert mich die Art, wie auf der Wewelsburg in einem der Räume das SS-Besteck ausgestellt ist. Es liegt einfach in einem Plastik-Geschirrkasten. Die Idee ist, die Dinge zu zeigen, aber nicht so sehr aufzuladen, sagt die Direktorin dort Wenke und mir, durch die ganze Ausstellung der NS und SS-Vergangenheit des Ortes werde die Präsentation der Exponate so angegangen: ohne Überhöhungen. Das bekannteste Beispiel für diesen entmystifizierenden Umgang mit dem Nationalsozialismus ist wohl dieser – und ich erzähle vielleicht erstmal, was ich vorab davon gehört habe: Vorab wurde mir erzählt, dass es auf der Burg ein in ihren Boden eingelassenes Hakenkreuz geben würde, dass man dieses nie herausgenommen hätte, weswegen das Museum es nun versuche zu kaschieren, indem es Sitzsäcke darüber auslege. Tatsächlich sitzen Wenke, die Direktorin und ich, zwischen den Bean Bags auf Sitzhockern zusammen herum im besagten Raum und auf dem besagten Motiv, das allerdings kein Hakenkreuz sondern ein zwölfspeichiges Rad, ein Sonnenrad, ist. Dieser Raum, Obergruppen- führersaal genannt, befindet sich direkt über der ebenfalls kreisrunden, geplanten aber nie genutzten Gruft für SS Führer im Nordturm. Wo wir zu dritt da sitzen, leuchtet mir das mit den Bean Bags ein, auch der ganze Ansatz der Entmystifizierung. Als wir bei den diversen Nazi-Exponaten sind und die Direktorin uns nochmal dort den Ansatz erklärt, muss Wenke allerdings kurz lachen und sagt, dass sie das verstehen könne, aber die Sache sei, dass die Sachen eine Ästhetik, eine Ausstrahlung hätten, anziehend wären. Ich schenke Wenke später meinen Ausstellungskatalog, den mir die Direktorin wiederrum geschenkt hatte (vielen Dank). Es gibt diese Aussage, die ich vor Jahren mal aufgeschnappt und mir immer gemerkt habe, ein Freund und Walter Benjamin-Fan, Raphael, sagte mir später, dass sie von Benjamin sei: Faschismus ist die Ästhetisierung der Politik. Dazu ergänzend mein ehemaliger Wohnungsnachbar Manuel in Köln, als ich mal wieder bei ihm drüben war eines Abends (als wir noch miteinandersprachen, bevor er grußlos wegzog): Manuel befand, dass Demokratie nicht ästhetisch sein könne und dürfe, sie müsse sich immer unbefriedigend anfühlen für den Einzelnen, matschig, kompromiss- beladen, gerade, dass sie nie ganz funktioniere, sei, was ihre Freiheit kennzeichne. Manuel schlief in der Wohnung in einem Schlafsack auf den Kacheln im Bad und einmal im Jahr, mindestens, ging er für ein paar Wochen wandern im Wald, pennte auch dort. Er hat Malerei studiert. Mir haben seine Bleistift-Skizzenbücher immer am Meisten gefallen.
...
Davor hingen in einem der den Inhaftierten gewidmeten Räume eine Winter- und eine Sommeruniform aus dem KZ Niederhagen. Ein Angehöriger eines Überlebenden hatte die Kleidung Jahre später gefunden. Sie ist gestreift, sieht alt aus, sieht komisch echt aus. Ansonsten ist im Raum mit der Kleidung noch eine Tube Klebstoff (ich meine, die Marke war „Moment“, die russische Variante von Pattex) ausgestellt, der Kleber wurde in der Zwangsarbeit zum Ankleben von Kragen an Kleidungsstücke verwendet, die Inhaftieren nutzen ihn wiederrum, um den Hunger zu betäuben. Mir fällt irgendwann auf, dass es ein Ungleichgewicht zwischen der Anzahl an hinter- lassenen Objekten der Inhaftierten und der der hinterlassenen und ausgestellten Objekte der Täter gibt und dass das a.) in den Begebenheiten des ausgeübten Unrechts an sich liegt und b.) gleichwohl ein komisches Gefühl erzeugt, als ob es dieses Unrecht auch heute noch einfacher habe, sich vordränge, sich unmerklich und immer wieder neu einschreibe, in unsere Zeit, die halt nicht nur unsere ist oder sein sollte, sondern auch die der Leute vor uns, irgendwie vielleicht auch gerade derer, die man zwang, aus ihr zu gehen. Was es gibt, sind Geschichten von Überlenden, in einem der letzten Räume, und Fotos, Fotos einiger der Überlebenden, im höheren Alter abgelichtet, einer wurde fast 100 oder so. Zeit, die Geschichten in diesem Raum anzuhören, haben Wenke und ich an diesem Tag aber auch nicht, ich muss nach der Führung durch die Direktorin gleich weiter zum nächsten Termin an der Wewelsburg.
...




Prophetien III
Die letzten Wochen brechen an. Ich geh noch zur Pride Parade, schau mir an, wie sie langsam aufgebaut wird am Rathausplatz, von der Terrasse der ersten Etage des Buffet-Restaurants Wang aus. Wang ist wie immer eine Bank. Danach, am Platz, unter den Menschen, fühlt es sich ein bisschen so an, als ob ich wieder auf der Gamescom sei, viele nerdige Kids unterwegs, und sie sind aber alle irgendwie so ganz aufgeregt, happy, wie es scheint, nur die Hitze setzt vielleicht ein bisschen zu, es ist wirklich unvergebend heiß an dem Tag. Ich frag mich, wie mein eigenes Leben verlaufen wäre, hätte ich selber in meiner Jugend beim CSD in Köln mitgemacht, und ich meine mitgemacht, Bella hatte mich ein paar Mal in meinen jungen Erwachsenenjahren zum Zuschauen dorthin mitgeschleppt, aber da war das, was – um mal eine viel zu theatralische und irgendwie auch unpassende Referenz zu gebrauchen – Herta Müller in Atemschaukel das Sich-immer- wieder-in-Schweigen-Einpacken nannte, schon zu häufig geschehen, und es freut mich, dass so viele junge Leute auf der Pride Parade sind, es macht Hoffnung, ich seh Brillenschlangen, wie ich sie früher eine war und auch immer noch eigentlich bin, in genderfluiden Outfits, und viele der Leute sehen auch echt ganz gut slutty aus, und das ist die Zukunft, die hoffentlich sich jetzt langsam mal ihren Weg bahnt, durch die immer noch andauernde Prüderie der Tage (es braucht alles Zeit). Während der letzten Monate hatte ich zwischendurch ab und zu gedacht, dass ich zur Parade in meinem roten Kleid oder zumindest vielleicht in meinem weit wehenden Hemd mit Motiven aus der Unterwasserwelt des Ozeans (das mir Melda mal in Köln bei Pick’n’Weight geschenkt hatte) gehen könnte, geschminkt dann natürlich, aber der Ablauf der Gedanken und Tage und Wochen entwickelt sich schließlich anders als erwartet, am Ende sehe ich am Tag der Parade wie immer aus, trage das lila T-Shirt von der japanischen Tischtennis-Marke und meine Deutsche Post- Hose, und laut einem Aushang sollte die Parade um drei losgehen, um halb vier regt sich immer noch kein Wagen, dafür ist es proppenvoll, neben Teenies scheinen auch viele Leute gekommen zu sein, die so wirken, als ob sie auch gerne Helene Fischer oder Meat Loaf hören, sie sind das echte Rückgrat dieser Gesellschaft, mit den Kids, und ich geh zurück nach Haus, durch die unsagbar volle Bielefelder Bahnhofsstraße, die an diesem Samstagnachmittag zusätzlich noch voll von missionierenden christlichen Gruppen ist (Zufall?), und in einer halben Stunde fängt auf Eurosport die Live- Übertragung meines Lieblings-Autorennens an, das gibt es auch nur einmal im Jahr.
...


Epilog: Gewitter
...
Ich seh Thea nochmal, sie hat mich zum Pickert-Essen zu sich nach Hause eingeladen, später sink ich immer tiefer in die Couch in ihrem Wohnzimmer ein, in dem urigen Haus, dass sie sich mit einer Mitbewohnerin teilt, tatsächlich leben die beiden in einem ganzen (schmalen) Haus, auf dem Rückweg komm ich nachts an den Schaufenstern der Neuen Westfälischen (der Roten) vorbei, und seh mein eigenes Gesicht von der dort präsentierten Ausgabe des nun vergangenen Tages zurückgucken, sie haben das Interview also heute gedruckt, ich geh an das Schaufenster heran, direkt neben mir steht ein Mann, der sehr nah an der Scheibe konzentriert die dort präsentierte Doppelseite der Zeitung liest, und würde er jetzt nur einmal kurz zu mir herüberschauen und zu dem Zeitungsausschnitt, vor dem ich gerade stehe, würde er was ganz Lustiges zu sehen bekommen, wage ich zu behaupten, vielleicht will ich auch einfach nur endlich meinen ersten Star-Moment haben. Passieren tut dann nichts.
...


Nun bricht wirklich die letzte Woche an. Ich muss packen, bemerke, dass ich viel zu viel habe, um es alles in einen (großen) Rucksack und eine Tasche nach Berlin zum nächsten Stipendium zu bekommen, verbringe also die letzten Tage damit, relativ ineffizient, weil ich mich einfach nicht trennen kann, mehr- mals durch halb NRW zu fahren, mit Zug und Auto, um Sachen wegzubringen, nach Köln in den Keller der untervermieteten Wohnung. Meine Mutter leiht mir ihren kleinen unklimatisierten Peugeot Kombi dafür, mit dem ich dann mit bis zu 155 Sachen (nicht meiner Mutter erzählen, sie fährt 90 bis 110 damit), bei fast 30° über A1, 2, 33, 40, 45, 57 fahre, und den Preis an den Autobahntanken bezahle, in Form stattlicher Tankrechnungen. Davor sagt Judith kurz nochmal Tschüss, sie hat mir sogar ein Geschenk mitgebracht, einen kleinen Holzengel, für mich und meinen Vater, sie bringt Grüße von Wolfgang mit, nimmt mich mit in die Stadt, ich muss, wie immer, zur Kingsgard-Reinigung und zum Fotospezialisten, sie fährt davon, in dem Auto, von dem sie selbst sagt, dass sie darin ein absoluter Einpark-Champ ist, ich glaub es ihr aufs Wort. Am letzten Tag vorm Auszug dann, nachdem mir Thea eine SMS geschrieben hat, dass sie eine Abschiedspost gerade an meiner Tür hinterlassen habe, nachdem Alexandra und ich den Küchentisch, den Alexandra von einer Freundin geliehen hatte, damit ich einen Arbeitstisch in der letzten Wohnung habe, zu besagter Freundin, auseinandergebaut, in einem Fahrradanhänger, zurückgebracht haben, und nachdem mir Alexandra auf dem Hinweg zu meiner Wohnung vom Kulturbüro- Abschiedsessen zuvor erzählte hatte, wie die letzten vier Monate eigentlich für sie emotional gewesen waren und was sie sich von mir gewünscht hätte, ohne, dass das jetzt aber als Vorwurf zu verstehen sei, und nach dem Kulturbüro-Abschiedsessen selber halt (in demselben Nudelladen, in dem auch das Ankunftsessen stattfand, eine Symmetrie), und nachdem mir der Schneider, als ich meine geflickte Mamba-Käppi bei ihm auf dem Weg zum Abschiedsessen abholte (vielen Dank dafür), angeboten hatte, dass er einen Kontakt herstellen könne, bei dem ich für Zweitausend in der Türkei meine Halbglatze mit Haaren aus meinem Nacken auffrischen lassen könnte (ich hatte einen Witz über meine Halbglatze gemacht), und nachdem ich leider keine Zeit gehabt hatte, der älteren Frau mit den Goldzähnen meine Hilfe beim Wegschleppen der neuverpackten Matratzen vom Straßenrand anzubieten, weil ich in Eile, auf dem Weg zum Schneider gewesen war – zuvor hatten wir uns versichert bei einer Anwohnerin, der ehemaligen Inhaberin der Matratzen tatsächlich, dass sie auch wirklich zu verschenken waren, die Frau mit Goldzähnen hatte mich davor auf der Straße angesprochen gehabt, ob ich meinte, dass die Matratzen zum Mitnehmen seien, wir hatten uns dann auf die Suche nach möglichen Inhabern gemacht am Haus, vor dem sie standen, am Ende hat sie sich einfach eine der Matratzen auf den Kopf gehievt und ist losgegangen, später am Nachmittag war keine der Matratzen mehr da vor dem Haus – nach alledem also, am allerletzten Nachmittag, schaue ich auf alles, was ich noch packen will für Berlin und bemerke, dass es weiterhin viel zu viel ist. Und in einem Gefühl, das keine Gefangenen mehr nimmt und trotzdem irgendwie auch keinen Mut kennt, entscheide ich mich, rigoros nun wirklich nur noch das Nötigste und das Praktischste mitzunehmen, und so werden das rote Kleid und die rosa Jogginghose und die roten und gemusterten Strumpfhosen in Mülltüten notverpackt, auch der Kasten mit den Schminkutensilien, am Tag zuvor hatte ich mir noch gesagt gehabt, dass ich diese Sachen mit nach Berlin nehmen werde, vielleicht kann ich mich ja dann da mal in der Öffentlichkeit am Wannsee in ihnen zeigen, Toni S. debütiert mit Mitte 30 in einem zu weiten Kleid von Ulla Popeken, gelassen hält er die grüne Berliner Weisse in der linken Hand, und alles zusammen wird nun stattdessen mit dem und im Peugeot Kombi meiner Mutter zurück nach Bochum gefahren und verstaut, hinter Regalen, auf dem vor Sachen überquellenden Dachboden meiner Eltern.

Um halb zehn abends bin ich zurück in Bielefeld. Ein Gewitter ist sich am An- bahnen. Ich gehe in den Garten, zum ersten Mal, der Garten besteht zur Hälfte aus einem ordentliche Stück Rasen und zur anderen Hälfte aus einem Streifen wild wachsender Gebüsche, im wilden Streifen liegt der Bungalow-Anbau an das Haupt-Wohnhaus, der meine Wohnung darstellt, ich setzte mich auf den Stuhl, auf dem sonst die eine Nachbarin aus dem Haus immer saß, in zumeist weißen Klamotten und mit ihrem Hund und ihrem Phone dabei, und schaue mich um. Durch das gekippte Fenster kann ich in meine Wohnung sehen, auf dem Fernseher, ich hab ihn angelassen, werden Motorradrennfahrer interviewt. Die Kirsche, die aus dem Garten emporragt, ist riesig. Efeu zieht sich vollständig ihren Stamm entlang. An den Rändern des eingezäunten Horizonts, gerade hinter den Häuserkanten, der Lagerhalle, deuten sich Blitze an. Es gibt auch Wind. Ich leg den Kopf in den Nacken, soweit, wie ich nur kann, und guck in die flatternden Äste der Kirsche über mir, die Wolkenmassive darüber, die ihr Gesicht bei bloßem Anblick ändern und dann wieder ändern, kleine Kirschen plumpsen aus dem Baum heraus. Es wird dunkel. Ich werde reingehen, wenn der Regen beginnt herunterzukommen.

le fin
Bonus: noch ein paar mehr Pics aus der Zeit