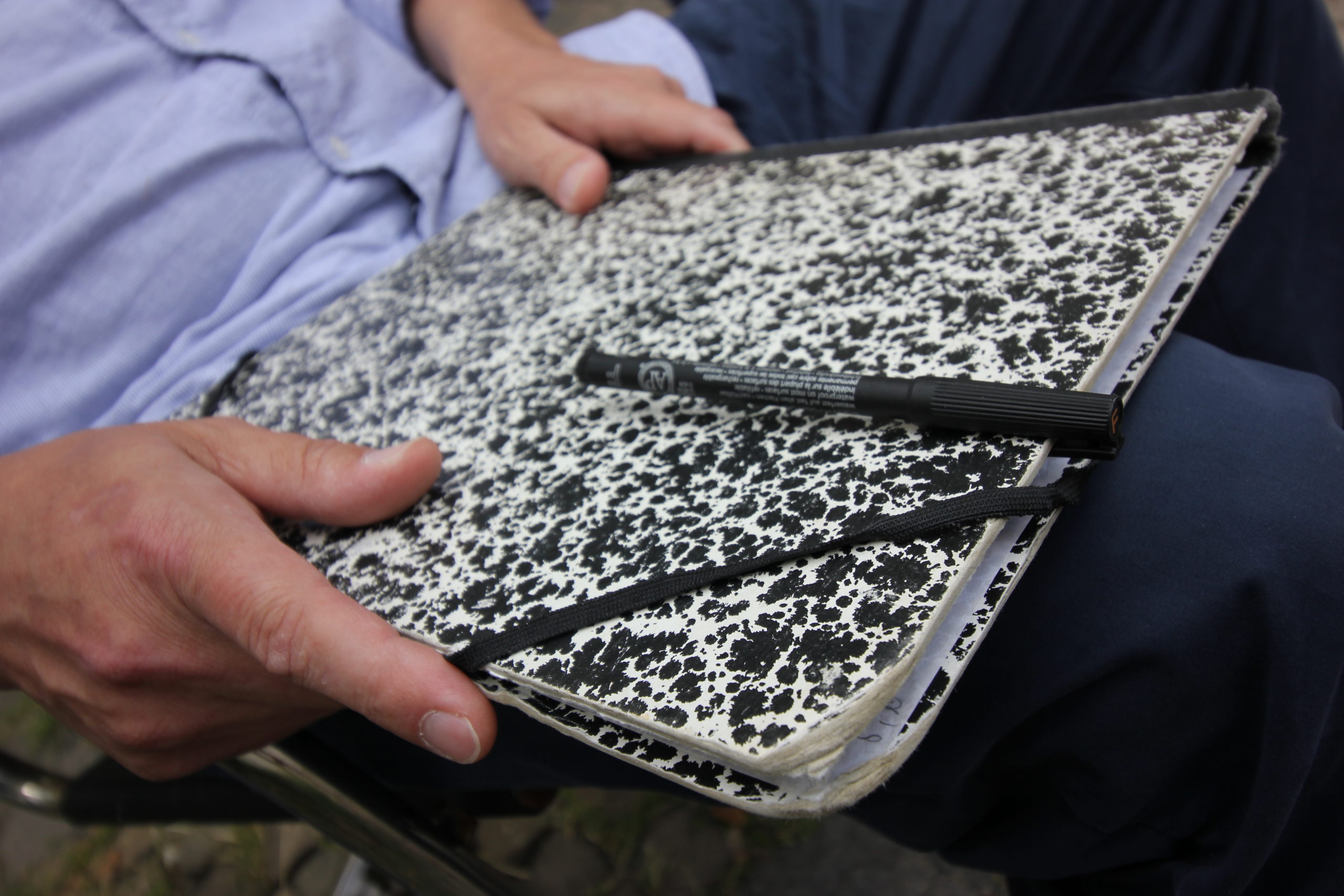Meine erste Woche auf Instagram oder: Tag 1. Instagram bahnt sich an.
25. April 2020
Fortsetzung meines Blogeintrags: Für stadt.land.text auf Instagram oder: Tag 0. Mein Leben vor Instagram
Im Dezember, Januar und Februar fühle ich mich noch schlau. Ich brauche kein Instagram.
Im Februar bin ich für ein Artist in Residence-Projekt zum Thema Europa in Vechta, Niedersachsen. Mein Projekt dort: Ich interviewe meine Gesprächspartner zu ihrer persönlichen Beziehung zu Europa und tippe alles ad hoc mit der Schreibmaschine mit, es entsteht: Ein Dialog, der unverändert bleibt. Das Original behalte ich, den Durchschlag bekommt mein Gesprächspartner. Ich liebe mein Projekt, ich liebe die Gespräche und all die interessanten Geschichten und Menschen, die ich treffe. Ich mache das Projekt mit Leidenschaft, interviewe in den vier Wochen 100 Menschen und knipse einen Haufen Fotos (die auch unbearbeitet bleiben sollen. Ich mache von den Dingen und Menschen und Situationen ja Fotos, weil ich sie besonders schön finde. Wieso sollte da noch ein Filter drauf. Das ist übrigens eine rhetorische Frage). Ich soll auch einen Blog pflegen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich die Vorstellung schon aufgegeben, die mediale Präsenz meiner Person relativ klein zu halten und meine Privatsphäre und Karriere außerhalb der Kunst damit zu schützen. Ich bin Künstlerin, Autorin, das vermischt sich irgendwie auch mit der Privatperson Larissa Schleher, ich poste, ich blogge, und an manchen Tagen sind mehr Journalisten bei mir als ich Finger an der Hand habe. Heute habe ich mich endlich dazu aufraffen können, die ganzen Zeitungen danach durchzusuchen, wo der Artikel von mir steht, und es hat lange gedauert. Dabei habe ich die Schönsten schon an Ostern verschenkt. Eine Zeitung für Oma, eine Zeitung für Mama, eine Zeitung für Papa.

Zum ersten und vermutlich letzten Mal im Leben ein D-Promi.

Yeah, Titelseite.
Ich sollte nur noch Projekte in Niedersachsen machen.
Ich lernte, dass man sich vor Interviews gut überlegen sollte, was man sagt – und nicht einfach drauf los babbeln, weil: Wenn man wenig sagt, wird zwangsläufig genau das aufgeschrieben, wenn man viel babbelt, sucht sich der Reporter irgendetwas davon raus, stellt es schräg zusammen und es kommen Sachen raus, die man so eigentlich nie gesagt hat, wenn man’s genau nimmt, aber das sollte man eben nicht mehr, irgendetwas genau nehmen, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt. Das kommt mir auch beim Bloggen in die Quere. Ich nehm’s gerne genau. Sehr genau. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, schnell mal etwas hochzuladen und zu schreiben, zu posten, was dann für immer – FÜR IMMER – oh mein Gott!, was für eine endlose Zeitspanne, zu finden ist – und vor allem, den Menschen gerecht zu werden, die ich interviewt habe. Die Menschen, die mit mir gesprochen haben, haben mir von Krankheit, Missbrauch, Gewalt, Krieg, Flucht, Armut und ihren geplatzten Träumen erzählt – und ich soll dazu innerhalb von kurzer Zeit etwas schreiben. Es fällt mir schwer. Ich will mit meinen Kommentaren den Interviews, den Menschen gerecht werden. Habe aber dazu gar nicht die Zeit, weil ich von einem Interview zum nächsten, von einem Termin zum anderen hoppe. Denke mir oft: Für die Außenwirkung wäre es vermutlich besser, du würdest wenig Leute interviewen, aber mehr von allem posten. Es wäre vermutlich besser, du würdest mit den Menschen keine drei Stunden quatschen, sondern für alle anderen da draußen drei Stunden bloggen. Aber man kann nicht alles zu 100% machen. Ich entscheide, dass die Durchführung des Projekts wichtiger ist. Das ist für mich die Kunst, meine wichtigste Aufgabe. Ich will die Blogeinträge nach und nach in Ruhe erstellen.
Bei einem Interview fragt mich mein Gesprächspartner, ob ich auch bei Instagram bin. Ich verneine. Er sagt: Das sollten Sie aber. Das ist doch heutzutage viel wichtiger als Facebook.
Äh ja, denke ich, klar, danke für den Tipp, vielleicht sollte ich das, vielleicht müsste ich das wirklich mal, karrieretechnisch und image und publicity und follower und influecer und was gerade alles wichtig und modern ist, aber irgendwie habe ich so gar keinen Bock drauf, so gar keine Zeit dafür, denke manchmal, du solltest alles Jämmerliche was du an social media hast, voll ganz deaktivieren und löschen und dein acht Jahre altes S3 mini aufgeben, das kleine Handy, dass du so liebst, weil es in jede Hosentasche passt und du noch nie ein anderes gehabt hast, außer dieses S3 mini, es ist für heute nicht besonders smart, aber es reicht, irgendwie, meistens auch nicht, aber das ist ja irgendwie egal, die Dinge, die man lange hat liebt man meistens, oder?, außer Fußpilz oder so was. Ich denke: Du solltest zu deinem ersten Handy zurück, das nur blau-schwarz und Tetris konnte. Dann hast du endlich wieder mehr Zeit für Blogeinträge, Waldspaziergänge, aus verschmierten Zugfenstern schauen und: Schreiben. Offline.
Schade, dass ich bereits ein neues Smartphone gekauft habe, weil es nervt, wenn weder Google Maps noch diverse Bahn- und Verkehrsapps funktionieren, wenn man viel unterwegs ist und absolut keinen Orientierungssinn hat, der Speicher permanent zu voll ist und man für jede 5-Sekunden-Sprachnachricht („hey, ich antworte dir später“) erst einmal 5 Minuten seinen Speicher leeren muss.
Das neue Smartphone liegt seit einem Monat eingepackt rum. Das Alte geht ja noch.
Dann beginnt das stadt.land.text-Projekt. NRW statt Niedersachsen. Düsseldorf statt Vechta. Für mich: Großstadt statt Kleinstadt. Aber eines bleibt gleich: Ich soll auch bloggen. Das kann ich. Mache ich auch brav. Dann kommt Corona. Es geht weniger live, plötzlich geht gar nichts mehr live, wir brauchen neue Projektformen, neue spreading-ausbreitungs-möglichkeiten, klingt gefährlich in dieser Zeit, I know, also instagramen wir jetzt alle, wir Regionenschreiber, freiwillig natürlich, aber ich sage mutig (nicht klug, das ist was anderes): Ich kann eine der Ersten sein, vielleicht die Erste, weil ich habe aktuelle Fotos von der photo+ Düsseldorf und aktuelle live-Interviews und das kann ich vielleicht nie wieder machen in meiner Stipendiatenzeit, Fotos von Kunstausstellungen mit echten Menschen und Fotos von Interviews, die ich nicht per Skype, sondern ganz nah dran geführt habe, und ich will das nicht in ein paar Wochen posten, da ist es doch veraltet, jetzt war die photo+, jetzt waren die Interviews, und ja, ich komme als zweite dran. Nach einem richtigen Social-media-Instagram-Profi (hi, Carla), das macht mir noch mehr Angst. Ich muss mich also ordentlich einarbeiten, wie man das so macht, wenn einem der Job eine neue Aufgabe beschert.
Und ich mache das gerne, weil ihr so nett seid, ihr habt ganz viele Flyer von mir gedruckt, auf denen mein Gesicht ist. Und ganz groß mein Name. Dafür arbeitet man sich natürlich auch in etwas ein. Ich beschließe, einen eigenen Account zu erstellen, dass ich das vorher auch testen kann, wie das geht, das Instagramen. Fühlt sich irgendwie ein bisschen nach Seele und Daten verkauft an, aber eine Woche ist ja kurz und das Profil schnell wieder gelöscht und ihr rettet mein Ostern, ich habe keine Geschenke, aber ich kann nicht nur Zeitungen verschenken, sondern auch Flyer. Meine Oma hat ihn gleich eingerahmt. Das ist schön. Vielleicht nie wieder D-Promi, aber für Oma ist man immer A-Promi.