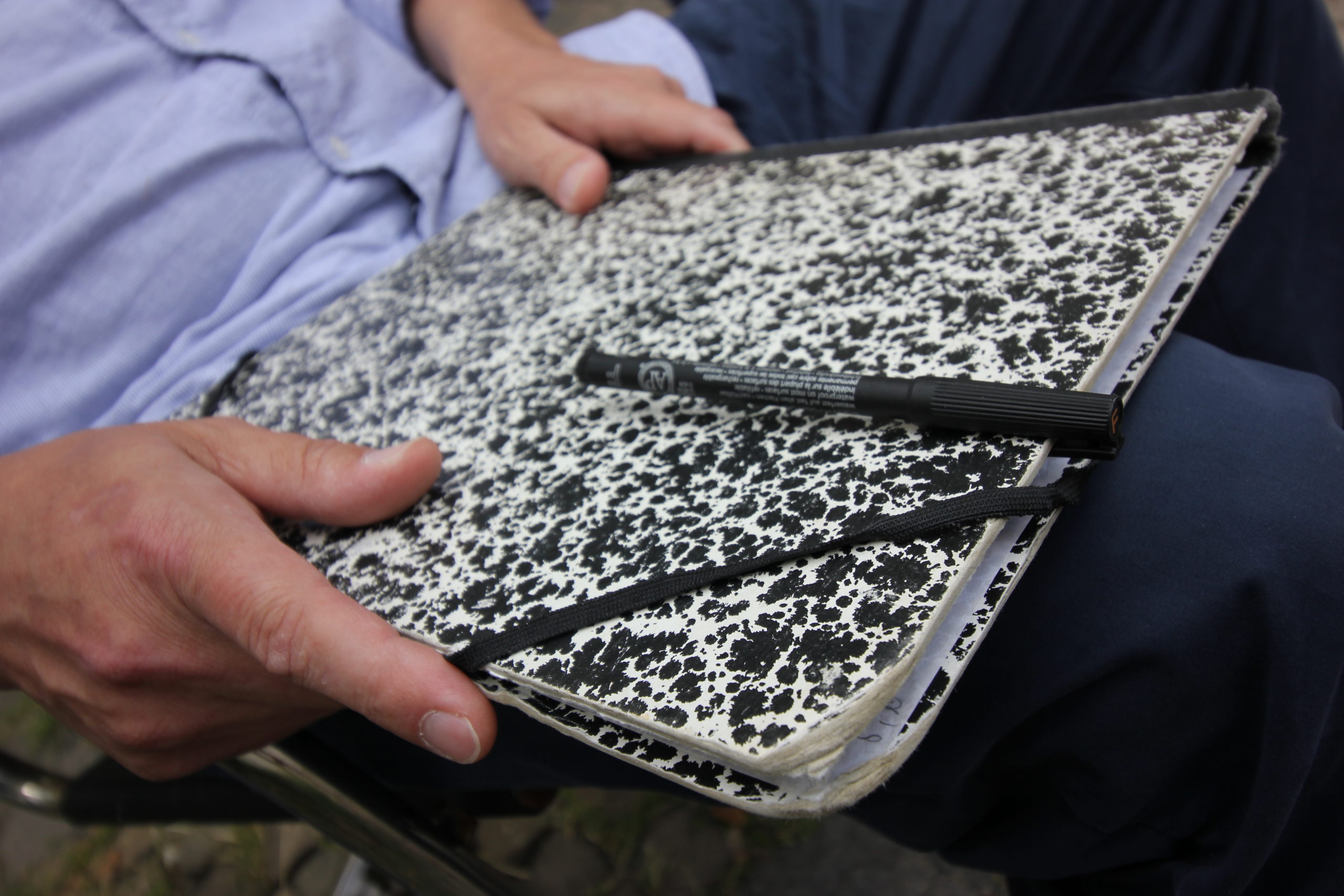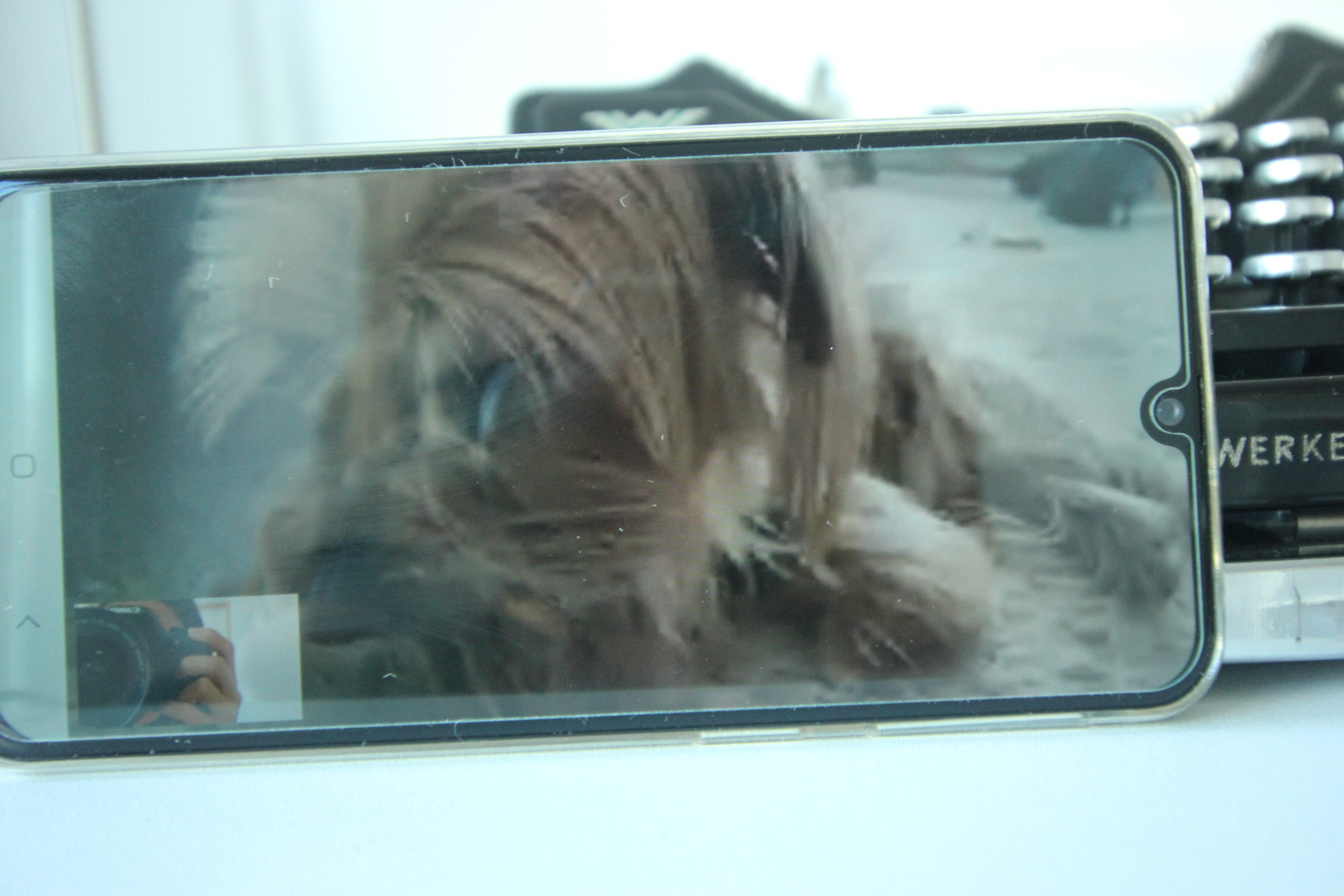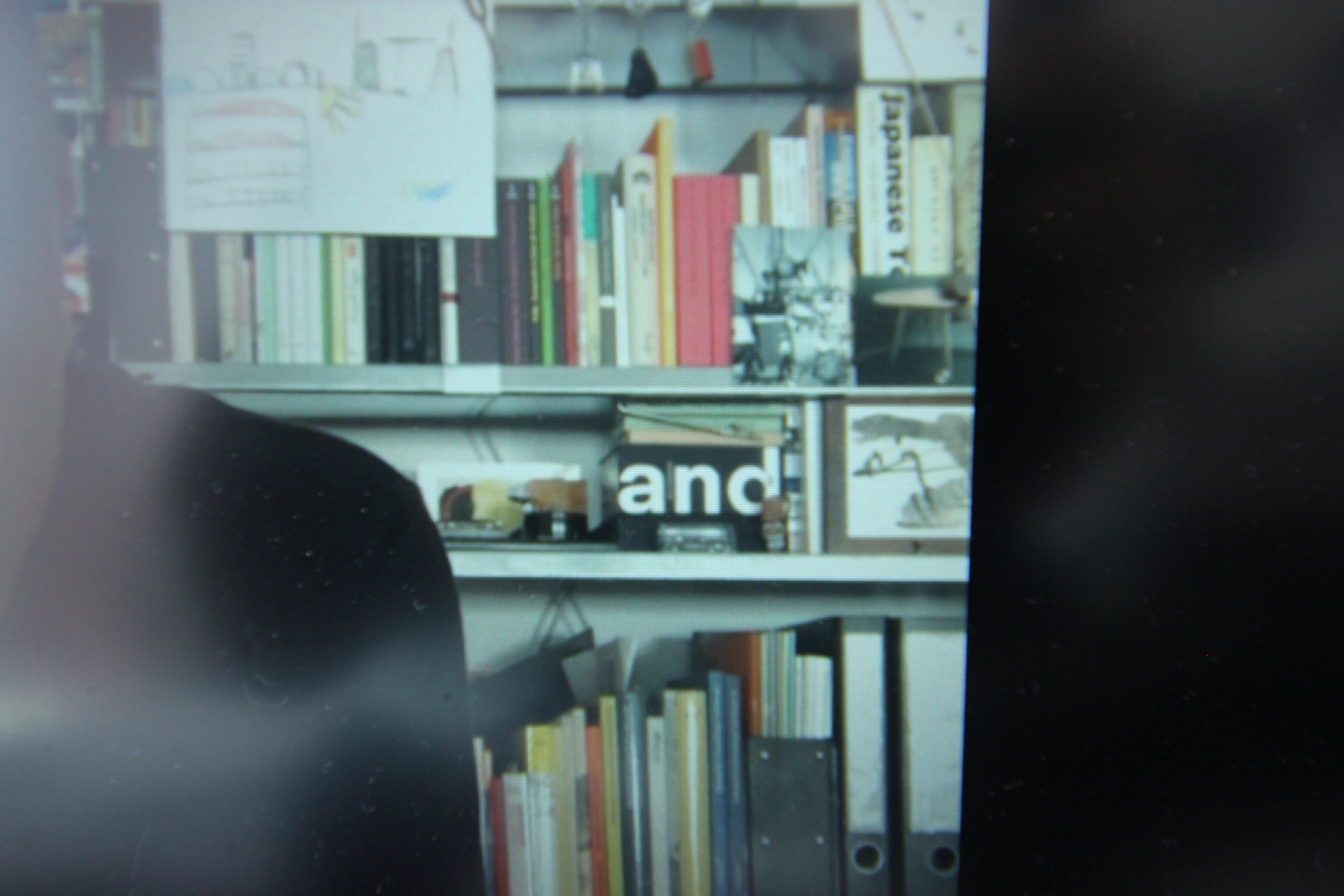Interview 18 – nur eben keine Messen gebaut, sondern Menschen getötet
23. Dezember 2020


Meine Finger hämmern über Stunden auf die Schreibmaschine, meine Fingergelenke schmerzen danach für mehrere Tage, obwohl ich nicht einmal alles mitschreiben konnte, was J. erzählt hat. 21 Seiten Interviewmaterial. Und wenn J. nicht irgendwann hätte los müssen, zu seinem Team, die für den Abend eine Live-Aufnahme vorbereiten mussten, hätten wir vermutlich noch viel länger miteinander gesprochen. Es ging um Lobbyismus, um Achtsamkeit, um Krieg, ums Töten, ums Sterben, um Korruption, um Politik, um Träume, um Projekte, Ideen, Visionen, um Familie, darum, wie es ist, wenn der Kontakt zu den Kindern abbricht, wie es ist, wenn man Geschäftsmann ist, in den großen thinks tanks unterwegs, über 1,3 Millionen im Jahr verdient und dann plötzlich alles verliert, wie man wieder auf die Beine kommt und warum das alles vielleicht eine große Chance ist.
Ich zitiere im folgenden drei Ausschnitte, aber am besten lest ihr das Interview einfach im Ganzen. Es lohnt sich!
TW: Gewalt / Krieg
J. erzählt von seinem humanitären Hilfseinsatz in Syrien:
„Die Syrer haben Bettlaken über die Straße gespannt, um den Scharfschützen die Sicht zu versperren. Aber wenn die Sonne falsch steht, sieht man die Schatten. Und plötzlich hören wir einen Knall. Und dann sinkt ein komplett weiß gekleideter Mann in das Laken. Blut läuft heraus. Und beim Tatort wird das immer so verniedlicht dargestellt, dabei läuft da alles aus einem heraus. Über den Randstein. Weil der ist ja zerschossen worden. Wenn ich mir das vorstell…ich bin ja auch Vater..ich hab den vor 30 Jahren schon Tarek genannt.“ Er lächelt. „Aber ich hab ihn seit 26 Jahren nicht mehr gesehen und er verachtet mich auch, aber ich schreib ihm immer noch Briefe, handgeschrieben, versuch meine Gedanken mit ihm zu teilen. Und hoffe, dass was auf ihn übergeht. Ich weiß nicht, was er mit den Briefen macht.“
Wir kommen auch auf J.s berufliche Vergangenheit zu sprechen:
„Mit 30 war ich ja schon senior consultant und Partner und von 89 bis 90 hab ich quasi die DDR im Alleingang auseinandergepflückt. Wir haben da die ganzen Beamten herausgeschmissen. Wurde damals von Brigit Breuel geleitet. Die wurde bestochen, persönlich Geld gegeben, ist jetzt auch dokumentiert. Das war n Machtspiel. N’Lobbyistenspiel der damaligen Beratungslobby. Bin mehrmals in Moskau gewesen. Hab dafür gesorgt, dass die ihre Aufträge zurückziehen und die Firmen für nothing bekommen. Die berühmten 5 Mark waren das damals. Wir haben da damals alle Maschinen raus. Überteuert wieder zurückgekauft. Die Marge war riesig. Und von diesem Geld wurden in China Flughäfen gekauft. Jeder dachte ja, jeder tut was gutes. Bescheid wusste da nur die oberste Etage. Man traf sich in Think Tanks zu nem guten Glas Cognac und ner Zigarre und überlegte, wie man Probleme zu lösen hatte. Das gibts im Kleinen und im Großen. Und der große Plan, der dahinter hing, war ja eigentlich der Sowjetunion zu schaden, da waren oft so lukrative Aufträge dabei, dass das Unternehmen überlebt hätte. Aber wir haben dann die Preise neu gemacht. Und sie mussten ihren Autrag zurückziehen. Wir haben da wirklich sehr viele Menschen unglücklich gemacht.“
Heute macht J. viele Menschen glücklich. Plant mit seiner Energie Projekte für andere Menschen; ein Künstlerhaus in Portugal oder eine Plattform in Düsseldorf, die Künstler fördert und unterstützt. Seine 200 Anzüge hat er alle verschenkt, an Geflüchtete. Einer hat neulich darin geheiratet.