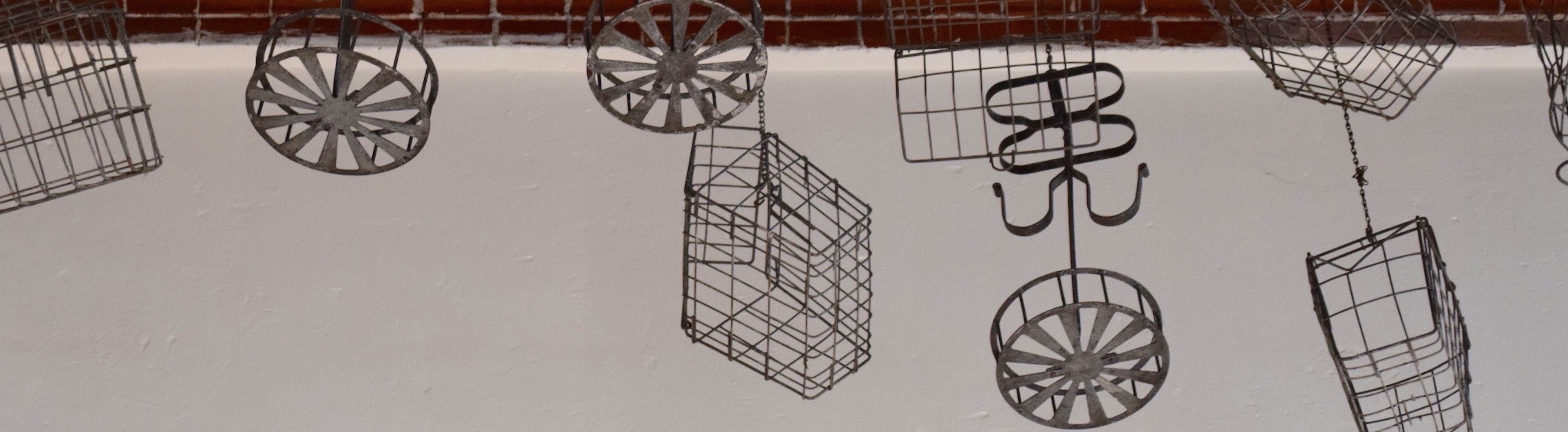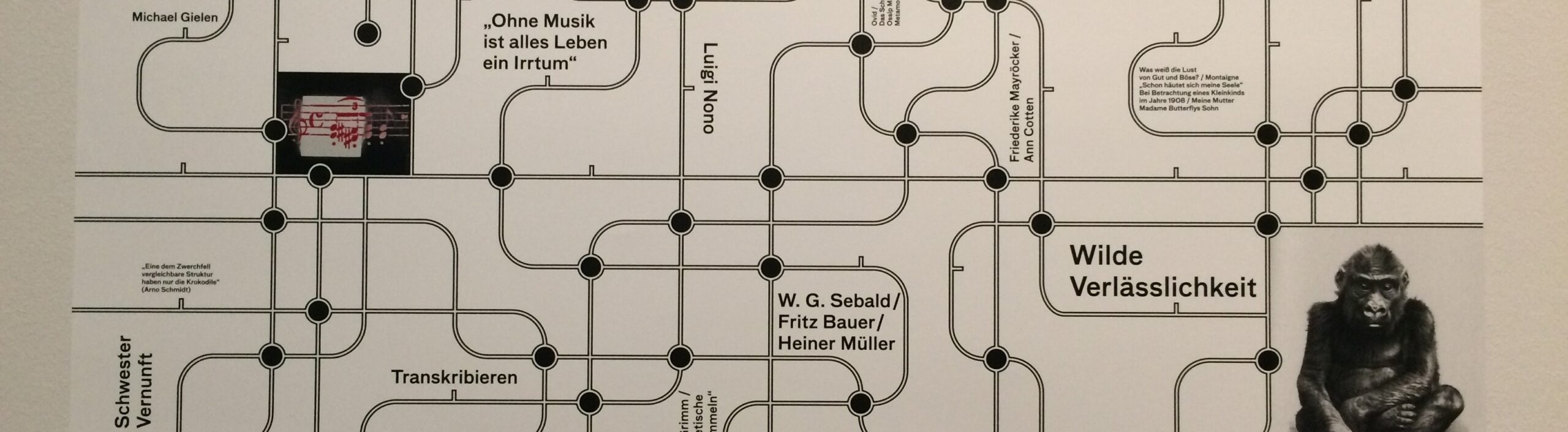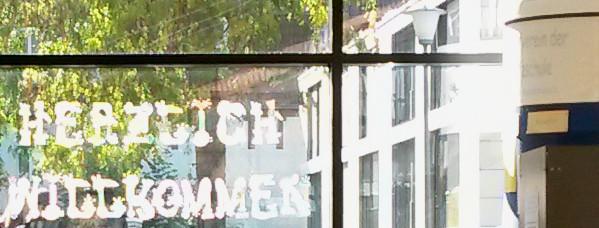Von gelebter Nachbarschaft
23. Juli 2017
Zu Gast in der Kulturregion Hellweg. Gefühlt ein Gast. Oder Fremder. Oder Eindringling. Oder Beobachter. Oder Besucher. Oder Beschreiber. Oder. Der Blick auf Fremdes spiegelt die eigene Fremde. Blick auf Unbekanntes macht das eigens Bekannte unbekannt.
Mein Zugang zur Region, zum Thema, sind Menschen, die Nachbarschaft neu organisieren. Eine Suche im Fass ohne Boden. Zahllose Einleitungen. In Gesprächen erfahre ich große Offenheit. In diesen Momenten bin ich dankbarer Gast.
Eine Seniorin, ehemalige Förderschulrektorin, initiiert ein Mehrgenerationenwohnen. Elf Wohneinheiten unter einem Dach. Junge Familien helfen Senior*innen, profitieren von Erfahrungen der Mittvierziger, deren Kinder gerade ausgezogen sind. Und umgekehrt, in allen denkbaren Konstellationen. Unter dem Dach des Hauses ist der Lebensmittelpunkt, hier wird Dorf simuliert. Oder Großfamilie. Man lebt gemeinsam. Miteinander und füreinander.
Der Rektor einer Hauptschule. Sein Engagement, seine Offenheit haben der Schule neues Profil verschafft. Vor der Schließung bewahrt. Ein Resultat: Schüler*innen, die das Bergmannslied lernen. Schüler*innen, die zuhause feststellen, dass auch in ihrem Wohnzimmer Partikel dieser Vergangenheit noch auf dem Sofa sitzen, in den Regalen stehen. Das Bergmannslied ist noch bekannt, öffnet verschlossene Stollen der Erinnerung, treibt Tränen in die Augen. Ein anderes Resultat: Schüler*innen, die einen Geschichtspfad bauen. Geschichte erfahrbar machen, Geschichte lebendig halten. Verpflichtung nicht nur Ämtern und Schüler*innen gegenüber, sondern auch dem Ort, der Region. Der Nachbarschaft. Lokaler Tradition und Geschichte, alten Werten.
Weniger Gemeinschaft hingegen im Zentrum. Haben Zentrum und Großstadt Fluktuation gemeinsam, Anonymität? ‚Verwässert‘ das Zentrum? Das Zentrum einer Stadt war einmal die Kirche, der Marktplatz.
Ein Mehrgenerationenhaus im Zentrum Hamms. Es versucht sich darin, Zentrum im Zentrum zu sein. Anlaufstelle für alle. Babytreff, Frühlingsfest, Stricktreff, Tanzstunde. Taschengeldbörse, Smartphonekurs. Angebote für neue Beziehungen. Angebote für Raum. Sich und auch Unbekanntem zu begegnen. Nachbarschaft braucht Begegnung braucht Raum. Ein Gut, das immer knapper wird. Hier wird es angeboten.
Direkt neben der Zentralen Unterbringungseinrichtung, voll von wartenden Menschen, mit langer Reise hinter, langer Reise vor sich, ein erstmal unauffälliges Haus. Im Schatten der Sommerhitze sitzen Senior*innen. Ein wöchentlicher Kaffeetreff. Im ersten Stock ein großer Gemeinschaftsraum. Die Küche wie aus dem Katalog, nur größer. Eine Tafel für vierzig, fünfzig Menschen, blitzsauber. Ein ganz normales Seniorenheim. Jede Bewohnerin, jeder Bewohner mit eigener Wohnung. Sie haben viel Leben hinter sich. In diesem Haus finden sie neue Gemeinschaften und verknüpfen ihre vielen Leben.
Noch nicht ganz viel Leben, aber eine lange Reise hinter sich haben sieben junge Männer. Nach Deutschland gekommen in den vergangenen zwei Jahren, geflohen. Vor Krieg, zum Beispiel, vor Verfolgung und anderem. Geflohene. Minderjährig und alleine, viele Landesgrenzen überquert. Oder das Mittelmeer. Ein Jugendhilfeträger bringt sieben minderjährige, unbegleitete Geflüchtete in einem Seniorenheim unter. Doch kein ganz normales Seniorenheim. Zwei Generationen und viele Kulturen treffen im Kleinen aufeinander.
Ich denke an mögliche Konflikte. An Missverständnisse, an Vorurteile, an Befremden. Differenzen in Alter, in Sozialisierung, in kulturellem Hintergrund. Sicher ist auch das ein Teil der Wahrheit, doch ich erlebe vor allem: Gemeinschaft. Empathie. Solidarität. Heranwachsende, die von Senior*innen bei der Hand genommen werden. Im Gegenzug: Senior*innen, denen die Tasche getragen oder der Einkauf erledigt wird. Im Kühlschrank Kartoffelsalat, den die Seniorin aus dem Nachbarzimmer den Heranwachsenden für den Hunger am späten Abend zubereitet hat. ‚Nicht, dass da einer hungrig schlafen gehen muss.‘
Die Eltern der sieben leben anderswo, weit weg. Manche der sieben sprechen regelmäßig mit der Heimat. Manche überhaupt nicht. Eine kommunikative, eine emotionale Stille. Die Senior*innen sind neue Großeltern. Und Mitbewohner*innen. Sozialpädagog*innen in mobiler Betreuung erfüllen andere, noch diversere Rollen. Manchmal auch solche einer Familie. Dem Sprichwort, es brauche ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, wird in diesem Haus auf neue Weise Rechnung getragen.
Die Frage nach Heimat liegt wieder auf dem Tisch. Hart, kantig, schwer, abstrakt, ungreifbar. Heute unbekannt, morgen Nachbar, das ist möglich. Heute Nachbar, morgen Freund. Oder Familie. Oder Feind. Das ist auch möglich. Menschen, die sich als Ur-Westfalen betiteln. Oder echte Deutsche. Überzeugte Europäer. Global citizens. Nicht allzu relevant in der realen Begegnung.