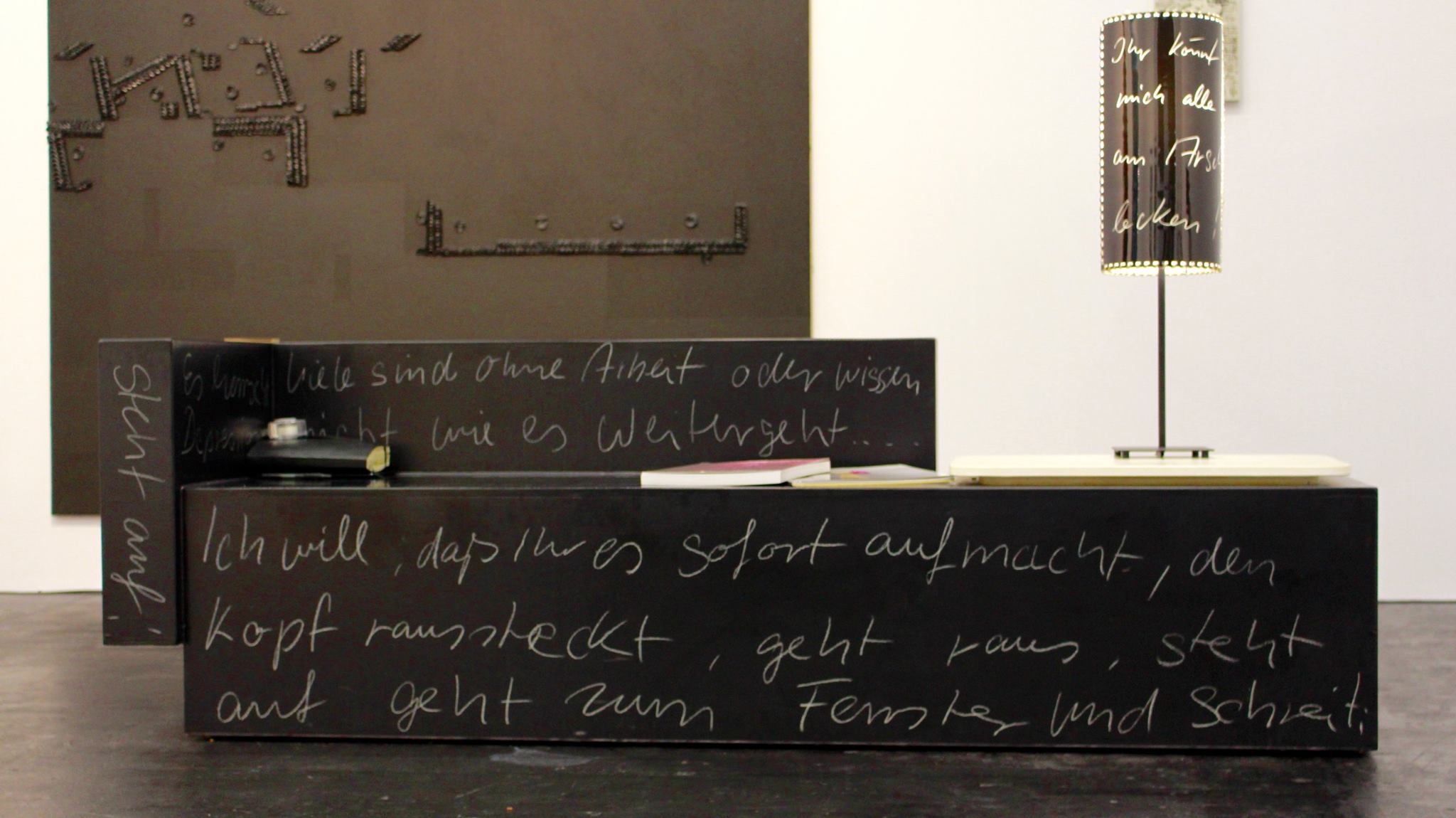Vamos a la playa
8. August 2017
Vamos a la Playa
Da vorne, da in dem Wald habe ich meine Kindheit verbracht. Ich habe alle mittelgroßen morschen Baumstämme aufgehoben und umgedreht auf der Suche nach Ameisen. Einmal habe ich eine gegessen. Sie rannte auf meiner Zunge herum bis ich sie verschluckte. Als ich abends im Bett lag, konnte ich nur noch an diese Ameise denken. Wie sie jetzt durch meinen Körper krabbelt. Wenn ich heute nicht einschlafen kann glaube ich manchmal, sie lebt immernoch dort und krabbelt durch meinen Körper, obwohl ich es besser weiß.
Ich habe den Bach gestaut der durch den Wald verläuft. Ich. Ich habe den mächtigen Bach gestaut, mit meinen eigenen Händen, mit meinen eigenen Füßen, mit Steinen und mit Baumrinde für die kleinen Ritzen zwischen den Steinen. Mit allem was zu finden war, haben wir einen Staudamm gebaut. Meine Kinder und Kindeskinder haben später den Wald besetzt und in den Bäumen gewohnt. Als die Bagger kamen, konnten sie nichts ausrichten.
Ich habe den Stachelbeerstrauch auf der Wiese neben der großen Straße da vorne gefunden. Ich habe ihn als Geheimnis bewahrt und einmal die Woche besucht, bis mir ein Freund lieb genug war, das Geheimnis und die Stachelbeeren mit ihm zu teilen.
Ich habe auf dem Weg zu Schule immer getrödelt. Ich habe den ganzen Weg geschafft, ohne die Ritzen zwischen den Gehwegsplatten zu berühren. Auf den Heimweg von der Schule habe ich meine Hand im Gehen an den Häuserwänden entlang streifen lassen. Die Fingerkuppen waren danach schwarz, obwohl die Häuser auf dem Weg alle weiß oder gelb gestrichen waren. Meine Mutter sagte zu mir, ich sähe aus wie ein Verbrecherin, die man überführt hat, so könne ich, dürfte ich nicht mitessen. Ich schrubbte und schrubbte meine Hände, aber es ging nie wieder ab.
Ich war die, die über die Mauer da geklettert ist um den Ball zu holen. Ich habe mich an Dornensträuchern gepiekst. Ich habe mich an Brennesseln verbrannt, aus Versehen, aus Notwendigkeit und aus Mut. Ich habe ein Fahrrad geklaut und ich wurde erwischt. Ich habe einen Stein nach Jemandem geworfen und ihn getroffen und es hat mir fürchterlich leid getan.
In unseren Klamotten sind wir im Sommer in den Brunnen gestiegen bis uns zu kalt wurde. Auf dem warmen Asphalt haben wir uns trocknen lassen bis ein Auto kam. Dann standen wir auf und ließen das Auto durch und wenn es durchgefahren war, dann legten wir uns wieder hin, wenn wir trocken waren gingen wir nach Hause.
Meine Eltern schickten meine Brüder am Wochenende morgens zur Bäckerei um Brötchen zu holen. Am Abend davor legten sie dafür etwas Geld auf dem Telefontisch, damit sie länger schlafen konnten. Wir saßen dann immer zusammen im Garten, da auf der Terrasse. An einem Morgen war ich als erstes wach. Ich nahm das Geld und ging zum Bäcker, obwohl ich noch viel zu klein war. Der Laden hatte noch zu. Also ging ich wieder zurück und legte mich in mein Bett. Niemand hatte etwas bemerkt. Aber ich vergaß die leere Straßen nicht.
Ich habe da hinten auf dem Ascheplatz ein Fußballturnier gewonnen im Elfmeterschießen. Und danach ein Fahrrad in der Tombola. Die ganze Mannschaft ist jubelnd mit dem Pokal um den ganzen Platz gelaufen als wäre es die Weltmeisterschaft gewesen. Und ich bin mit dem Fahrrad hinterher. Da vorne standen die Flutscheinwerfer. Und da war der Ballcontainer. Ungefähr.
An einem Sommer als ich dreizehn war, ging ich jeden Tag raus um in dem hohen Gras zu spazieren. Jeden Tag. Ohne zu wissen was ich dort, oder irgendwo auf der Welt wollte oder sollte. Ich konnte an jedem Tag die Spuren sehen, die ich am Tag zuvor hinterlassen hatte. Als die Schule wieder anfing, kam ich nicht mehr. Und danach auch nicht.
In der Kneipe haben wir uns später besoffen. Die Wirtin kannte meine Eltern, aber sie hat ihnen nie etwas gesagt. Es war besser für sie Umsatz zu machen und besser für uns, wenn keiner von uns noch mit dem Roller fuhr, sondern zu Fuß nach Hause ging. Nicht selten krachte auch mal einer gegen einen Baum.
In der Kirche ging mein Opa zur Kommunion, meine Mutter ging dort auch zur Kommunion. Mein Vater ging in der Kirche vom Nachbarsdorf zur Kommunion und meine Mutter hat ihn dort geheiratet, aber mich hat man auch in diese hier geschickt. Gefirmt hat man mich da auch.
Später saßen wir im Urlaub jeden Tag mit einem Sechserpack Wasserflaschen am Strand, weil viele über das Meer kamen, um sich vor dem neuen Krieg und der Hitze zu retten. Damals fing das gerade erst an. Aber es wurden mehr und mehr und so viele Wasserflaschen konnte man gar nicht besorgen.
Auf der betonierten Treppe neben der Schule habe ich gesessen und geraucht. Zum ersten Mal. Und dann immer wieder. Es war der heimlichste Ort hier. Dort habe ich später geküsst, gekifft. Einmal habe ich dort auch geweint. Ich habe nicht geweint als man die Bodenplatten rausriss, und die Schule gleich mit, das war mir egal. Aber ich würde mich gerne nochmal dort hinsetzen, auch um eine zu rauchen. Das war der Ort der kleinen Freiheit.
Ich habe meinen Kopf durch den Zaun gesteckt wenn Besuch kam. So wie unser Hund. Er kannte nur den Blick durch den Zaun, und den Gang durch das Dorf. Wenn ich hier stehe, kommt es mir vor als steckte mein Kopf auch immer noch in diesem Zaun fest.
Ich habe alle Pflaumen eingesammelt im Garten von der anderen Familie. Ich habe jeden Wurm aus den Pflaumen herausgepult und in den roten Eimer geworfen und die ohne Wurm in einen grünen. Ich habe Zucker über den Pflaumenkuchen gestreut im Herbst, denn ohne ging es nicht. Da vorne hing die frische Wäsche, ich habe sie tausend mal von meinem Zimmer aus trocknen sehen. Und gelacht, wenn es regnete und sie hektisch abgehängt wurde. Und noch mehr gelacht, wenn man sie vergaß.
Ich habe das Motorengeräusch gehört, den Benzinduft geatmet und dem Reifengummi zugesehen als es wie Speck auf dem Teer von der Kartbahn brannte. Ich habe gesehen wie der Asphalt ausfranste und bröckelig wurde, als würde er vertrocknen wenn eine Weile niemand darauf fährt.
Der Apfelbaum. Der Apfelkuchen. Der Pflaumenbaum. Der Pflaumenkuchen. Das Auto in der Garage. Die Schaukel, die quietschte. Man hörte, wenn noch ein anderes Kind im Garten war, meistens aber nur den Wind. Der Fahrradständer schleift über den Boden an einem Sommerabend. Ein Propellerflugzeug stört die die Stille, die Vögel haben den Ort übernommen. Der Grill. Der Geruch. Der Nachbar flammt das Unkraut nicht mehr vom Gehsteig. Kommunion in der Kirche. Dasselbe Foto seit 3 Generationen: Mama, Papa, Kind, Kerze. Ein Haus das ich nie erben wollte. Der Horizont klebte mir hier am Auge.
Ich habe diesen Ort verlassen, bin durch die Welt gereist und niemals wiedergekehrt, auch wenn ich nun an derselben Stelle stehe.
In 80 Jahren ist das der Weg zum Strand. Warm wird es dann sein. Sehr warm. Das Meer ist dann vielleicht hier angekommen. Und die Vögel müssen im Winter nicht fort.
Davon habe ich nichts. Mir bleibt nur der Übergang. Das panische Jetzt in dem wir leben. Mir bleibt, nicht das, was war. Und das, was wird, werde ich nicht sehen. Auch mir bleibt nur diese Lücke. Ich hab das ja immer gewusst, aber ich dachte es fühlt sich anders an.